Mietspiegel sind eine Referenz, um die ortsüblichen Vergleichsmieten zu ermitteln. Mit ihnen werden unter anderem Erhöhungen von Mieten bei Neuverträgen begründet – auch im Bereich der Mietpreisbremse. Sie werden alle zwei Jahre im Rahmen von Umfragen erhoben. Was dabei herauskommt, hängt unter anderem davon ab, welche Haushalte den Bogen überhaupt ausfüllen und wie viele teilnehmen – je nachdem kann das Bild der Mietsituation am Wohnungsmarkt erheblich verzerrt werden. Kurz: Die Datenlage ist unter Umständen ziemlich schief und spiegelt nicht die tatsächliche Situation wider.
Daher soll das Mietspiegelrecht 2021 reformiert werden. Ziel ist es, die Qualität und Verbreitung von Mietspiegeln zu stärken und die Rechtssicherheit für Mieter wie Vermieter zu erhöhen. Zur Stärkung der Rechtssicherheit eines Mietspiegel sollen die Grundsätze, nach denen qualifizierte Mietspiegel zu erstellen sind, zukünftig auf das Wesentliche beschränkt werden und maßgeblichen wissenschaftlichen Grundsätzen in einer Mietspiegelverordnung folgen.
Dazu soll eine neue Vermutung wirksam werden: Wurde ein Mietspiegel sowohl von der zuständigen Behörde als auch von Vertretern der Mieter- und Vermieter-Seite als qualifiziert anerkannt, so soll in Zukunft gelten, dass dieser wissenschaftlichen Grundsätzen entspricht.
 Grundsätzlich sollen Mieterhöhungen bei Wohnungen, für die es einen Mietspiegel gibt, dann nur noch mit genau diesem Mietspiegel oder aber einem Sachverständigengutachten begründet werden dürfen. Bisher können sich die Vermieter auch auf Vergleichswohnungen beziehen, was immer wieder zu Streitigkeiten führte. Diese qualifizierten Mietspiegel sollen allerspätestens alle fünf Jahren neu erstellt werden.
Grundsätzlich sollen Mieterhöhungen bei Wohnungen, für die es einen Mietspiegel gibt, dann nur noch mit genau diesem Mietspiegel oder aber einem Sachverständigengutachten begründet werden dürfen. Bisher können sich die Vermieter auch auf Vergleichswohnungen beziehen, was immer wieder zu Streitigkeiten führte. Diese qualifizierten Mietspiegel sollen allerspätestens alle fünf Jahren neu erstellt werden.
Ein klares Ziel des Gesetzes ist es, die Auswirkungen kurzfristiger Schwankungen des Mietwohnungsmarktes auf die Vergleichsmiete zu verringern und den Anstieg der Mieten zu verlangsamen. Das ist ganz entscheidend, ist doch neben Mieterhöhungen in laufenden Mietverhältnissen auch die Mietpreisbremse für neu abgeschlossene Mietverträge an die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete gekoppelt.
Datenschutzrechtlich schwierig erscheint bei der Reform, dass zur Verbesserung der Bedingungen für die Erstellung qualifizierter Mietspiegel die zuständigen Behörden Befugnisse zur Datenverarbeitung erhalten sollen. Erleichtert werden soll zudem die Nutzung vorhandener Daten, etwas aus dem Melderegister oder bei der Verwaltung der Grundsteuer bekannt gewordene Angaben sowie Daten aus der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus.
Und auch bei einem weiteren Punkt greift der Staat deutlich ein: Zur Erhöhung der Rückläufe aus den Befragungen und zur Vermeidung von Verzerrungen durch selektives Antwortverhalten soll eine Auskunftspflicht eingeführt werden. Damit würden Vermieter und Mieter von Wohnraum verpflichtet, Auskunft über ihr Mietverhältnis und über die Merkmale der Wohnung zu erteilen. Zur Senkung des damit verbundenen Aufwands soll der Bindungszeitraum von Mietspiegeln von zwei auf mindestens drei Jahre verlängert werden.
Foto: Jürgen Fälchle

 Eigentümer der im Nachlass benannten Immobilie werden dann die gesetzlichen Erben (in der Regel Kinder und Ehegatte) – entsprechend ihrer Quote. Sind mehrere Erben vorhanden, entsteht eine so genannte Erbengemeinschaft. Diese ist gesetzlich auf Auseinandersetzung gerichtet, was bei Streitigkeiten zwischen den Miterben dazu führt, dass die Immobilie oft verkauft werden muss. Grund ist, dass die Erbengemeinschaft nur gemeinschaftlich handeln kann. Liegt hingegen ein Testament vor, so fällt die Immobilie den darin eingesetzten Erben zu. Sofern der Erblasser das Haus oder die Wohnung aber im Testament nicht einem bestimmten Erben übertragen hat, entsteht auch in diesem Fall eine Erbengemeinschaft.
Eigentümer der im Nachlass benannten Immobilie werden dann die gesetzlichen Erben (in der Regel Kinder und Ehegatte) – entsprechend ihrer Quote. Sind mehrere Erben vorhanden, entsteht eine so genannte Erbengemeinschaft. Diese ist gesetzlich auf Auseinandersetzung gerichtet, was bei Streitigkeiten zwischen den Miterben dazu führt, dass die Immobilie oft verkauft werden muss. Grund ist, dass die Erbengemeinschaft nur gemeinschaftlich handeln kann. Liegt hingegen ein Testament vor, so fällt die Immobilie den darin eingesetzten Erben zu. Sofern der Erblasser das Haus oder die Wohnung aber im Testament nicht einem bestimmten Erben übertragen hat, entsteht auch in diesem Fall eine Erbengemeinschaft. Wurden Pflichtteilsberechtigte durch den Erblasser enterbt oder durch eine letztwillige Verfügung unter die Höhe des Pflichtteils gesetzt, so erhalten sie ihren Anspruch darauf. Aber auch Schenkungen aus dem Vermögen der Verstorbenen, die innerhalb der letzten zehn Jahre zuvor getätigt wurden, können einen Pflichtteilsanspruch entstehen lassen – eben, wenn unter fiktiver Hinzurechnung des Schenkungswerts die Höhe des Erbes die Höhe des Pflichtteils nicht mehr erreicht.
Wurden Pflichtteilsberechtigte durch den Erblasser enterbt oder durch eine letztwillige Verfügung unter die Höhe des Pflichtteils gesetzt, so erhalten sie ihren Anspruch darauf. Aber auch Schenkungen aus dem Vermögen der Verstorbenen, die innerhalb der letzten zehn Jahre zuvor getätigt wurden, können einen Pflichtteilsanspruch entstehen lassen – eben, wenn unter fiktiver Hinzurechnung des Schenkungswerts die Höhe des Erbes die Höhe des Pflichtteils nicht mehr erreicht.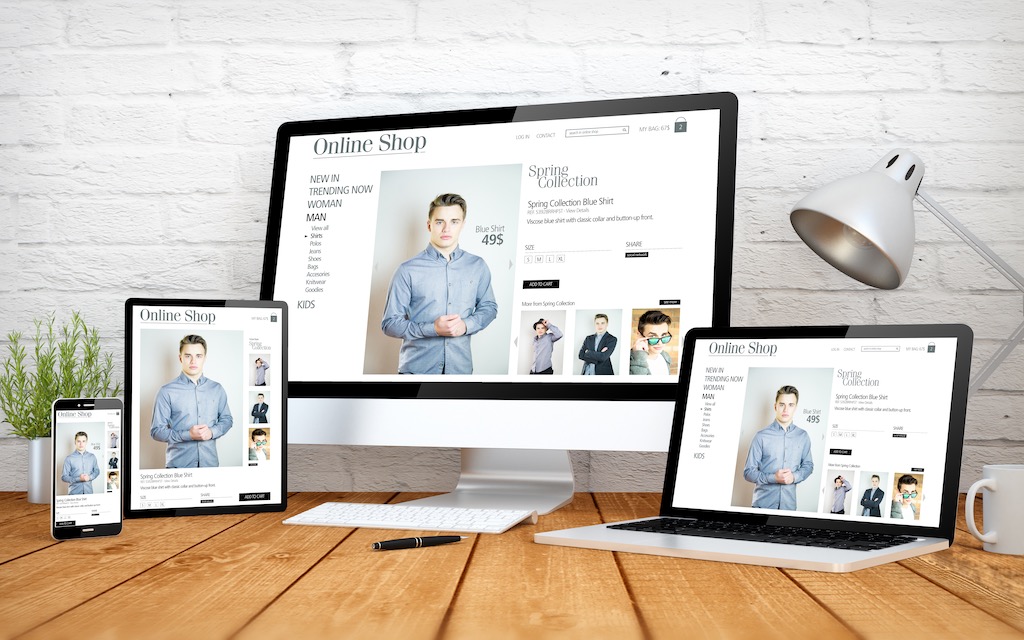 Im Fall des OLG Hamm ging es um eine Abmahnung und anschließende Klage des Mitbewerbers eines Online-Händler, der auf „Amazon“ Taschenmesser der Herstellers Victorinox angeboten. Victorinox wiederum gewährt eine (teilweise) zeitlich unbeschränkte, sogenannte Victorinox-Garantie. Der Händler hatte diese Garantie nicht weiter beworben, sondern lediglich in einem Untermenü der Angebotsseite den Hyperlink „Weitere technische Informationen“ eingebettet. Bei dessen Anklicken wurde das auf Amazon als PDF-Datei gespeicherte Informationsblatt des Herstellers geöffnet. Dazu müssten, dem Urteil nach, Angaben kommen, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, doch die waren eben so wenig enthalten, wie der Hinweis auf die davon unabhängigen gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Im Fall des OLG Hamm ging es um eine Abmahnung und anschließende Klage des Mitbewerbers eines Online-Händler, der auf „Amazon“ Taschenmesser der Herstellers Victorinox angeboten. Victorinox wiederum gewährt eine (teilweise) zeitlich unbeschränkte, sogenannte Victorinox-Garantie. Der Händler hatte diese Garantie nicht weiter beworben, sondern lediglich in einem Untermenü der Angebotsseite den Hyperlink „Weitere technische Informationen“ eingebettet. Bei dessen Anklicken wurde das auf Amazon als PDF-Datei gespeicherte Informationsblatt des Herstellers geöffnet. Dazu müssten, dem Urteil nach, Angaben kommen, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, doch die waren eben so wenig enthalten, wie der Hinweis auf die davon unabhängigen gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Das Landgericht Essen stellte klar: Entgegen der Auffassung der Beklagten sei das Versprechen, die zuständige Aufsichtsbehörde zukünftig im Impressum anzugeben, keine unangemessene Benachteiligung – etwa weil es ihr subjektiv unmöglich sei. So sei es der Beklagten grundsätzlich ohne weiteres möglich, in ihren geschäftlichen Internet-Auftritten die für sie zuständige Aufsichtsbehörde zu benennen. Kurz: Die Beklagte sei zu keiner unmöglichen Handlung verpflichtet.
Das Landgericht Essen stellte klar: Entgegen der Auffassung der Beklagten sei das Versprechen, die zuständige Aufsichtsbehörde zukünftig im Impressum anzugeben, keine unangemessene Benachteiligung – etwa weil es ihr subjektiv unmöglich sei. So sei es der Beklagten grundsätzlich ohne weiteres möglich, in ihren geschäftlichen Internet-Auftritten die für sie zuständige Aufsichtsbehörde zu benennen. Kurz: Die Beklagte sei zu keiner unmöglichen Handlung verpflichtet. Vor allem wollte der BGH wissen, ob die Telefonnummern auch dann als „verfügbar“ gelten, wenn der Onlinehändler den Telefonanschluss zwar geschäftlich nutzt, nicht aber für den Abschluss von Fernabsatzverträgen verwendet und damit auch nicht zur Rückabwicklung in Form einer Entgegennahme von Widerrufserklärungen vorhält.
Vor allem wollte der BGH wissen, ob die Telefonnummern auch dann als „verfügbar“ gelten, wenn der Onlinehändler den Telefonanschluss zwar geschäftlich nutzt, nicht aber für den Abschluss von Fernabsatzverträgen verwendet und damit auch nicht zur Rückabwicklung in Form einer Entgegennahme von Widerrufserklärungen vorhält. In einem anderen Fall musste sich das Landgericht Koblenz (Urteil vom April 2020) mit einer Influencerin auseinander setzen, die Beiträge unter der Nennung eines Friseursalons postete. Der Salon gab zwar eine Erklärung ab, wonach er bestritt, eine geschäftliche Beziehung mit der Influencerin zu pflegen; diese wurde vom Gericht allerdings als inhaltlich falsch gewertet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Influencerin durch die Postings versuche, die Verbraucher zu beeinflussen und so, mittelbar den Absatz zu fördern.
In einem anderen Fall musste sich das Landgericht Koblenz (Urteil vom April 2020) mit einer Influencerin auseinander setzen, die Beiträge unter der Nennung eines Friseursalons postete. Der Salon gab zwar eine Erklärung ab, wonach er bestritt, eine geschäftliche Beziehung mit der Influencerin zu pflegen; diese wurde vom Gericht allerdings als inhaltlich falsch gewertet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Influencerin durch die Postings versuche, die Verbraucher zu beeinflussen und so, mittelbar den Absatz zu fördern. Bei den beiden deutschen Fällen ist diese Richtlinie noch nicht anwendbar. Der EuGH wurde daher um die Klarstellung der Haftung der Betreiber nach den derzeit geltenden Regelungen ersucht. Dies ist auch der Grund für Saugmandsgaards Antrag. In dem einen Rechtsstreit geht Frank Peterson, ein Musikproduzent, gegen YouTube und deren Muttergesellschaft Google wegen des Hochladens mehrerer Tonträger im Jahr 2008 vor, an denen er verschiedene Rechte haben soll. Dieses Hochladen erfolgte ohne seine Erlaubnis durch Nutzer der Plattform. Im zweiten Fall geht die Verlagsgruppe Elsevier wegen im Jahr 2013 erfolgten Einstellung verschiedener Werke auf der Sharehosting-Plattform Uploaded vor, an denen Elsevier die ausschließlichen Rechte hält. Der mit diesenRechtsstreitigkeiten befasste BGH hatte die Verfahren ausgesetzt und dem EuGH mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.
Bei den beiden deutschen Fällen ist diese Richtlinie noch nicht anwendbar. Der EuGH wurde daher um die Klarstellung der Haftung der Betreiber nach den derzeit geltenden Regelungen ersucht. Dies ist auch der Grund für Saugmandsgaards Antrag. In dem einen Rechtsstreit geht Frank Peterson, ein Musikproduzent, gegen YouTube und deren Muttergesellschaft Google wegen des Hochladens mehrerer Tonträger im Jahr 2008 vor, an denen er verschiedene Rechte haben soll. Dieses Hochladen erfolgte ohne seine Erlaubnis durch Nutzer der Plattform. Im zweiten Fall geht die Verlagsgruppe Elsevier wegen im Jahr 2013 erfolgten Einstellung verschiedener Werke auf der Sharehosting-Plattform Uploaded vor, an denen Elsevier die ausschließlichen Rechte hält. Der mit diesenRechtsstreitigkeiten befasste BGH hatte die Verfahren ausgesetzt und dem EuGH mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. Langjährige Mieter können ihren Vermieter zum Renovieren verpflichten, müssen sich aber an den Kosten beteiligen, entschied der für das Mietrecht zuständige Zivilsenat des (BGH) mit einem im Juli 2020 veröffentlichten Urteil zu Schönheitsreparaturen. Die Entscheidung gilt für Mieter, die ihre Wohnung in unrenovierten Zustand bezogen haben, wenn sich deren Zustand sich in der Zwischenzweit deutlich verschlechtert hat.
Langjährige Mieter können ihren Vermieter zum Renovieren verpflichten, müssen sich aber an den Kosten beteiligen, entschied der für das Mietrecht zuständige Zivilsenat des (BGH) mit einem im Juli 2020 veröffentlichten Urteil zu Schönheitsreparaturen. Die Entscheidung gilt für Mieter, die ihre Wohnung in unrenovierten Zustand bezogen haben, wenn sich deren Zustand sich in der Zwischenzweit deutlich verschlechtert hat. Die Gegenseite meinte aber, dass von dem Brutto-Wiederbeschaffungswert die Umsatzsteuer von 19 Prozent abzuziehen sei. Sowohl das zuvor angerufene Amtsgericht als auch das Landgericht Heidelberg gaben der Klage des Unfallgeschädigten statt. Und so musste der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden.
Die Gegenseite meinte aber, dass von dem Brutto-Wiederbeschaffungswert die Umsatzsteuer von 19 Prozent abzuziehen sei. Sowohl das zuvor angerufene Amtsgericht als auch das Landgericht Heidelberg gaben der Klage des Unfallgeschädigten statt. Und so musste der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden.