Das Landgericht Berlin hat in einem Urteil vom August 2024 entschieden, dass die Firma Apple besser darüber aufklären muss, dass Sternebewertungen in ihrem „App Store“ nicht auf ihre Echtheit geprüft werden. Die bisherige Praxis des Unternehmens, einen entsprechenden Hinweis lediglich in den Nutzungsbedingungen zu verstecken, wurde vom Gericht als unzureichend bewertet. Es fehlt also eindeutig die Transparenzpflicht bei Sternebewertungen.
Hintergrund der Entscheidung ist eine seit dem 28. Mai 2022 geltende gesetzliche Verpflichtung für Anbieter von Online-Plattformen. Diese müssen transparent darüber informieren, ob und wie sie sicherstellen, dass Bewertungen tatsächlich von Verbrauchern stammen, die das Produkt oder die Dienstleistung genutzt oder gekauft haben. Die Vorschrift soll Verbraucher vor gefälschten Nutzerbewertungen schützen und ihnen ermöglichen, auf Basis authentischer Bewertungen fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.
 Im konkreten Fall hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) eine Klage gegen Apple Distribution International Ltd. eingereicht. Im „App Store“ werden bei der Beschreibung von Anwendungen die üblichen Sternebewertungen sowie Rezensionen von Nutzern angezeigt, einschließlich des Durchschnittswerts und der Verteilung der Bewertungen. Allerdings prüft Apple nicht, ob die Bewertungen von Personen stammen, die die jeweilige App tatsächlich auch genutzt haben. Dieser wichtige Umstand wurde nur in den Nutzungsbedingungen unter der Überschrift „Deine Beiträge zu unseren Diensten“ erwähnt.
Im konkreten Fall hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) eine Klage gegen Apple Distribution International Ltd. eingereicht. Im „App Store“ werden bei der Beschreibung von Anwendungen die üblichen Sternebewertungen sowie Rezensionen von Nutzern angezeigt, einschließlich des Durchschnittswerts und der Verteilung der Bewertungen. Allerdings prüft Apple nicht, ob die Bewertungen von Personen stammen, die die jeweilige App tatsächlich auch genutzt haben. Dieser wichtige Umstand wurde nur in den Nutzungsbedingungen unter der Überschrift „Deine Beiträge zu unseren Diensten“ erwähnt.
Das Landgericht Berlin stellte klar, dass diese Praxis irreführend sei. Die Richter betonten, dass es Verbrauchern nicht zumutbar sei, in den Geschäftsbedingungen nach wesentlichen Informationen zu suchen. Zudem würden Verbraucher nicht erwarten, einen solchen Hinweis unter der genannten Überschrift zu finden.
Die Entscheidung hat weitreichende Bedeutung für alle Unternehmen, die derartige Online-Bewertungssysteme anbieten. Die Transparenzpflicht bei Sternebewertungen betrifft dabei nicht nur Tech-Giganten wie Apple, sondern grundsätzlich alle Betreiber von Online-Plattformen mit Bewertungsfunktionen. Unternehmen müssen nun sicherstellen, dass Informationen zur Prüfung der Authentizität von Bewertungen für Verbraucher leicht zugänglich und vor allem verständlich platziert werden.
Das Urteil verdeutlicht die zunehmende Bedeutung von Transparenz im digitalen Handel. Schließlich stellen Sternebewertungen für viele Verbraucher ein wichtiges Entscheidungskriterium dar. Die mangelnde Überprüfung der Echtheit kann jedoch die Aussagekraft solcher Bewertungen erheblich einschränken. Durch die gerichtlich bestätigte Informationspflicht sollen Verbraucher nun besser einschätzen können, wie verlässlich die angezeigten Bewertungen tatsächlich sind.
Für Unternehmen bedeutet dies, ihre Bewertungssysteme äußerst kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen – um so den Transparenzanforderungen gerecht zu werden und rechtliche Risiken zu minimieren.
Urteil des Landgericht Berlin vom 29.8.2024; AZ – II52 O 254/23 –
Foto: Umar Draz

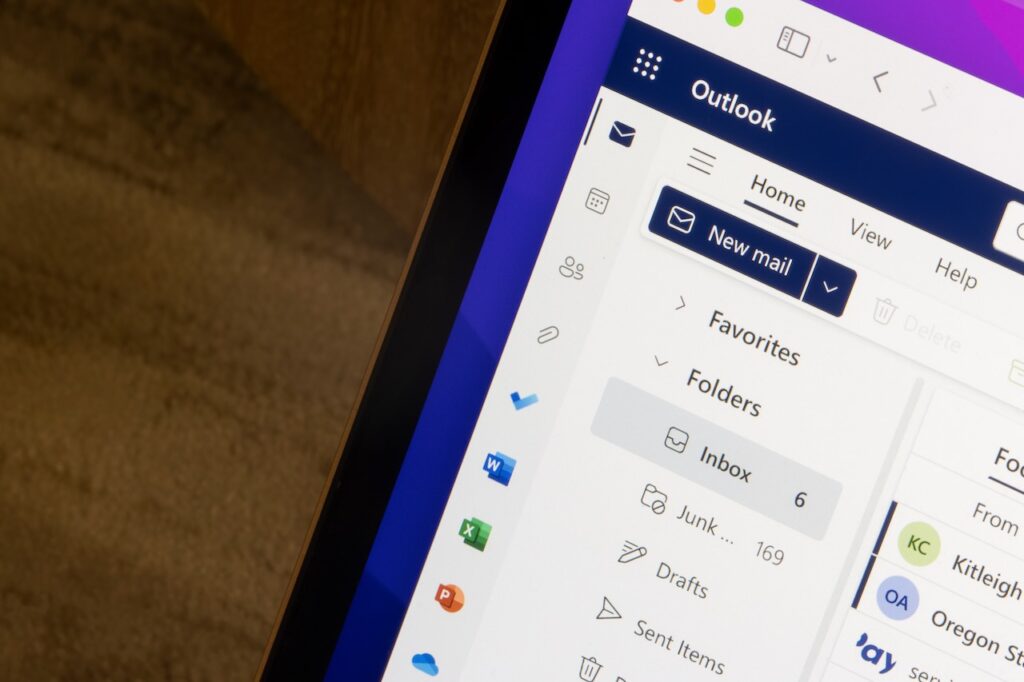 Im Fall von E-Mails wird jedoch festgehalten, dass der Empfang nicht so typisch ist, dass allein durch das Versenden auf den Zugang geschlossen werden kann. Es gibt immer wieder technische Gründe oder Filterungen, die den Empfang verhindern, was einen Anscheinsbeweis in solchen Fällen ausschließt.
Im Fall von E-Mails wird jedoch festgehalten, dass der Empfang nicht so typisch ist, dass allein durch das Versenden auf den Zugang geschlossen werden kann. Es gibt immer wieder technische Gründe oder Filterungen, die den Empfang verhindern, was einen Anscheinsbeweis in solchen Fällen ausschließt.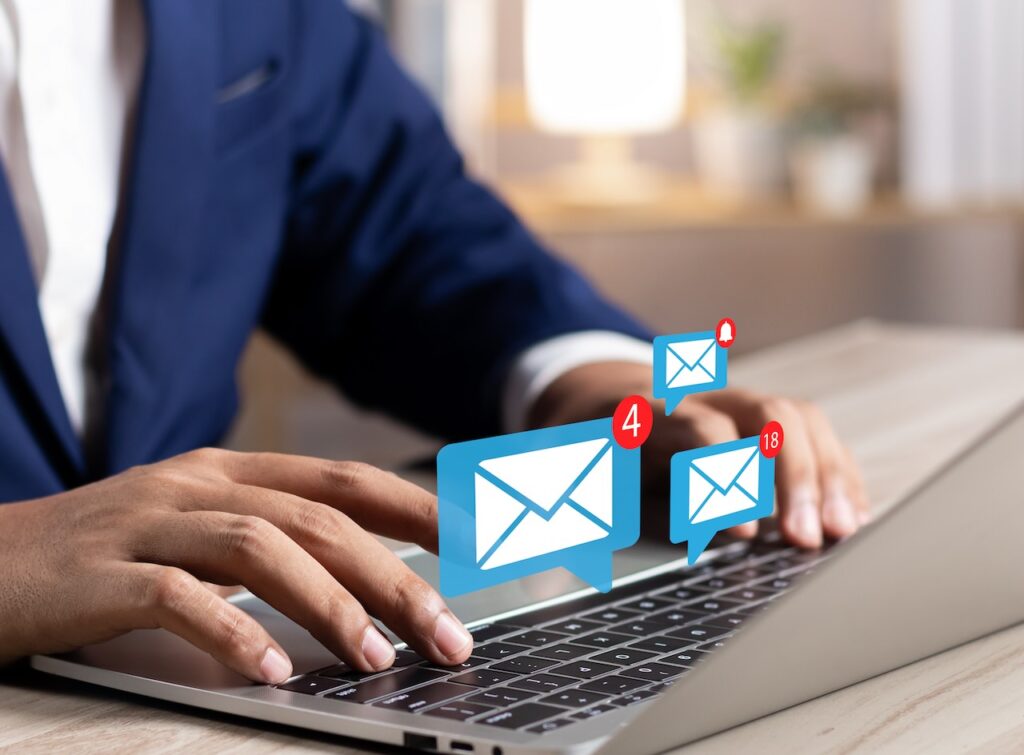
 Der Fall zeigt deutlich, dass die Sicherheit im Online-Banking nicht allein durch technische Maßnahmen gewährleistet werden kann. Nutzer müssen aktiv an der Sicherung ihrer finanziellen Transaktionen mitwirken. Es ist entscheidend, dass Benachrichtigungen auf ihre Authentizität hin überprüft werden, insbesondere wenn sie zur Freigabe von Transaktionen auffordern. In diesem Fall wurde der Kläger aufgrund seiner beruflichen Erfahrung und seiner Kenntnisse im Umgang mit Online-Banking als grob fahrlässig eingestuft.
Der Fall zeigt deutlich, dass die Sicherheit im Online-Banking nicht allein durch technische Maßnahmen gewährleistet werden kann. Nutzer müssen aktiv an der Sicherung ihrer finanziellen Transaktionen mitwirken. Es ist entscheidend, dass Benachrichtigungen auf ihre Authentizität hin überprüft werden, insbesondere wenn sie zur Freigabe von Transaktionen auffordern. In diesem Fall wurde der Kläger aufgrund seiner beruflichen Erfahrung und seiner Kenntnisse im Umgang mit Online-Banking als grob fahrlässig eingestuft. Die Angreifer bedienen sich oft namhaft klingender Unternehmen oder Institutionen, die beispielsweise im Finanz- oder Handelsbereich ansässig sind. Der Begriff Phishing stammt aus dem englischsprachigen Raum und bezeichnet im Prinzip einen Angelausflug. Hierbei dient eine eigens für den Angriff konzipierte E-Mail dem Cyberkriminellen als Köder, wobei er diesen gleich mehrfach an seine möglichen Opfer, wie z.B. an Mitarbeiter eines Unternehmens, weiterleitet.
Die Angreifer bedienen sich oft namhaft klingender Unternehmen oder Institutionen, die beispielsweise im Finanz- oder Handelsbereich ansässig sind. Der Begriff Phishing stammt aus dem englischsprachigen Raum und bezeichnet im Prinzip einen Angelausflug. Hierbei dient eine eigens für den Angriff konzipierte E-Mail dem Cyberkriminellen als Köder, wobei er diesen gleich mehrfach an seine möglichen Opfer, wie z.B. an Mitarbeiter eines Unternehmens, weiterleitet. Das Landgericht Frankenthal bestätigte diese Kündigung und unterstrich damit die Bedeutung eines respektvollen Umgangs in Social-Media, insbesondere in Bezug auf geschäftliche Beziehungen. Das Gericht erachtete die beleidigenden Posts als ausreichenden Grund für eine außerordentliche Kündigung. Hierbei spielte es keine Rolle, dass zwischen den Parteien bereits vorher Konflikte bestanden hatten. Entscheidend war die Art und Weise der Äußerungen des Gastwirts, die als persönliche Herabsetzung und Beleidigung eines Vorstandsmitglieds gewertet wurden.
Das Landgericht Frankenthal bestätigte diese Kündigung und unterstrich damit die Bedeutung eines respektvollen Umgangs in Social-Media, insbesondere in Bezug auf geschäftliche Beziehungen. Das Gericht erachtete die beleidigenden Posts als ausreichenden Grund für eine außerordentliche Kündigung. Hierbei spielte es keine Rolle, dass zwischen den Parteien bereits vorher Konflikte bestanden hatten. Entscheidend war die Art und Weise der Äußerungen des Gastwirts, die als persönliche Herabsetzung und Beleidigung eines Vorstandsmitglieds gewertet wurden.
 Webseiten-Betreiber können dem entgegenwirken, indem sie solche Google-Fonts direkt einbinden. Das funktioniert letztlich in gleicher Weise wie der Google-Dienst.
Webseiten-Betreiber können dem entgegenwirken, indem sie solche Google-Fonts direkt einbinden. Das funktioniert letztlich in gleicher Weise wie der Google-Dienst. 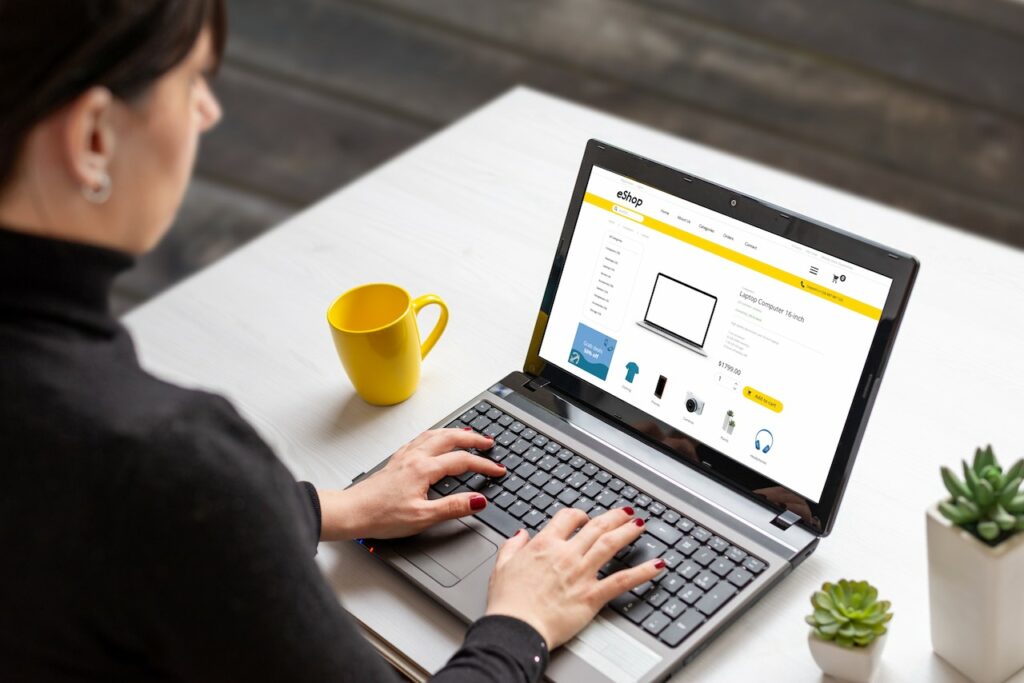
 Der Kläger bezog sich auf die Datenschutzgrundverordnung, nach der er jederzeit und insbesondere formlos kündigen bzw. weitere Werbe-E-Mails untersagen könne. Die Beklagte trug vor, dem Kläger sei auf seine Nachricht vom Dezember mitgeteilt worden, dass er ganz einfach die entsprechende Einwilligung im Kundenverwaltungssystem entziehen könne. Da der Kläger dies nicht getan habe, habe sie davon ausgehen können, dass seine Einwilligung weiterhin Bestand habe. Dem widersprach das Amtsgericht deutlich und urteilte im Sinne des Klägers.
Der Kläger bezog sich auf die Datenschutzgrundverordnung, nach der er jederzeit und insbesondere formlos kündigen bzw. weitere Werbe-E-Mails untersagen könne. Die Beklagte trug vor, dem Kläger sei auf seine Nachricht vom Dezember mitgeteilt worden, dass er ganz einfach die entsprechende Einwilligung im Kundenverwaltungssystem entziehen könne. Da der Kläger dies nicht getan habe, habe sie davon ausgehen können, dass seine Einwilligung weiterhin Bestand habe. Dem widersprach das Amtsgericht deutlich und urteilte im Sinne des Klägers.