Tierhaltung bedeutet Verantwortung. Halter eines Tieres haften für Schäden, die durch deren Tiere entstehen – sei es, dass das Tier direkt andere Tiere oder Menschen verletzt oder Gegenstände beschädigt werden. Doch nicht nur für unmittelbar durch das Tier verursachte Verletzungen gilt die Tierhalterhaftung. Es erfasst auch Fälle, in denen Personen sich aufgrund der vom Tier herbeigeführten Gefahr zu helfendem Eingreifen veranlasst sehen. Das hat Oberlandesgericht Frankfurt am Main im Januar 2023 entschieden. Es den Halter eines Hundes zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt, da dieser den Kater der Klägerin angegriffen hatte. Beim Versuch, die Tiere zu trennen, stürzte die Klägerin (vermutlich wegen Glatteis unter dem Schnee) und verletzte sich.
Was war passiert? Die Parteien sind Nachbarn und räumten im Januar 2017 gleichzeitig Schnee von ihren Grundstücken. Der Hütehund des Beklagten gelangte während der Räumarbeiten auf das Grundstück der Klägerin. Ob die Klägerin nachfolgend stürzte, da der Hund den Kater der Klägerin angegriffen hatte, ist zwischen den Parteien streitig. Das Landgericht hatte daher nach der Beweisaufnahme die auf Schmerzensgeld und Feststellung der Einstandspflicht für weitere Schäden gerichtete Klage abgewiesen. In der Berufung stellte das Oberlandesgericht dagegen fest, dass der Klägerin in jedem Fall ein Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadensersatz zustehe, dei Tierhalterhaftung voll greife. 
Nach der Beweisaufnahme sei davon auszugehen, dass die Klägerin gestürzt sei, da sich der Hund auf ihren Kater gestürzt und diesen am Kopf gepackt habe, so die Frankfurter Richter. Sie habe die Tiere mit ihrem Besen trennen wollen, was bis dahin sowohl die Angaben der Klägerin als auch die des Beklagten bestätigten. Der Beklagte hatte aber klargestellt, dass er lediglich gesehen habe, „dass sein Hund Schläge bezogen habe“. Die Sicht auf das weitere Geschehen sei dagegen verdeckt gewesen. Die Klägerin habe den Hund sicher nicht ohne jeden Grund geschlagen. Sie kannte den Hund vielmehr schon lange und hatte in der Vergangenheit regelmäßig mit ihm gespielt. Diese Angaben der Klägerin seien auch von Zeuginnen bestätigt worden. Aus der ärztlichen Stellungnahme ergebe sich zudem zweifelsfrei, dass die Klägerin in der fraglichen Zeit Verletzungen am Hand- und Kniegelenk erlitten habe.
Als Halter des Hundes habe der Beklagte damit für die erlittenen Schäden einzustehen, entschied das Gericht. Die verschuldensunabhängige Tierhalterhaftung bestehe bereits, wenn eine Verletzung „kausal auf ein Tierverhalten zurückzuführen ist“. Es komme nicht auf eine unmittelbar durch das Tier bewirkte Verletzung an. Ausreichend sei, „wenn sich ein Mensch durch die von dem Tier herbeigeführte Gefahr zu helfendem Eingreifen veranlasst sieht“, so die Frankfurter Richter. Die Klägerin habe sich durch den Angriff des Hundes konkret veranlasst gesehen, dem Kater zur Hilfe zu eilen. Auch wenn es angesichts der winterlichen Verhältnisse aus objektiver Sicht unklug gewesen sei, sich schnell auf die Tiere zuzubewegen, sei es doch eine völlig naheliegende Reaktion gewesen.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 18.1.2023; AZ – 4 U 249/21 –
Foto: Анна Иванова

 Da die Widersprüche bei der Gemeinde keine Reaktion brachten, hatten die Kläger im Oktober 2022 Klage gegen die Verfügungen erhoben. Zur Begründung machen sie im Wesentlichen geltend, dass für den Erlass der Verfügungen keine Rechtsgrundlage ersichtlich sei. Bei dem betreffenden Privatweg, von dem keine Gefahren ausgingen, handele es sich um einen privaten, nicht um einen öffentlichen Wirtschaftsweg.
Da die Widersprüche bei der Gemeinde keine Reaktion brachten, hatten die Kläger im Oktober 2022 Klage gegen die Verfügungen erhoben. Zur Begründung machen sie im Wesentlichen geltend, dass für den Erlass der Verfügungen keine Rechtsgrundlage ersichtlich sei. Bei dem betreffenden Privatweg, von dem keine Gefahren ausgingen, handele es sich um einen privaten, nicht um einen öffentlichen Wirtschaftsweg.
 Die Kläger wenden sich nicht gegen die Beurteilung des Landgerichts, wonach sich das Unterlassungsbegehren nicht auf eine Gesundheitsverletzung stützen lässt. Diese Beurteilung sei rechtlich auch nicht zu beanstanden. Sie nahmen auch die Annahme des Landgerichts hin, dass der beklagten Spedition keine wesentliche Beeinträchtigung der Benutzung zuzurechnen sei. Auch insoweit sind Rechtsfehler des Landgerichts nicht ersichtlich.
Die Kläger wenden sich nicht gegen die Beurteilung des Landgerichts, wonach sich das Unterlassungsbegehren nicht auf eine Gesundheitsverletzung stützen lässt. Diese Beurteilung sei rechtlich auch nicht zu beanstanden. Sie nahmen auch die Annahme des Landgerichts hin, dass der beklagten Spedition keine wesentliche Beeinträchtigung der Benutzung zuzurechnen sei. Auch insoweit sind Rechtsfehler des Landgerichts nicht ersichtlich. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin blieb ohne Erfolg. Die Richter am Oberverwaltungsgericht in Münster argumentierten, dass der Einwand der Antragstellerin, die unbedingt zu prüfenden Belange des Wohls der beiden Tiere, seien nicht hinreichend berücksichtigt worden, sei unzutreffend. Die Antragstellerin habe keinerlei Gesichtspunkte aufgezeigt, dass die Haltung von Hängebauchschweinen eine in einem Wohngebiet zulässige Kleintierhaltung sei. Ob die Haltung der Schweine durch die Antragstellerin tatsächlich zu einer Belästigung der Nachbarn durch Gerüche führt, sei denn auch unerheblich.
Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin blieb ohne Erfolg. Die Richter am Oberverwaltungsgericht in Münster argumentierten, dass der Einwand der Antragstellerin, die unbedingt zu prüfenden Belange des Wohls der beiden Tiere, seien nicht hinreichend berücksichtigt worden, sei unzutreffend. Die Antragstellerin habe keinerlei Gesichtspunkte aufgezeigt, dass die Haltung von Hängebauchschweinen eine in einem Wohngebiet zulässige Kleintierhaltung sei. Ob die Haltung der Schweine durch die Antragstellerin tatsächlich zu einer Belästigung der Nachbarn durch Gerüche führt, sei denn auch unerheblich. Das wollte dieser nicht hinnehmen, die Verstöße mit den drei auf ihn zugelassenen Fahrzeugen hätten andere Personen begangen. Gegen die Entscheidungen habe er lediglich kein Rechtsmittel eingelegt um der Behörde Arbeit zu ersparen. Die Verhängung einer Fahrtenbuchauflage als milderes Mittel hätte zunächst greifen sollen – er sei beruflich auf die Fahrerlaubnis angewiesen.
Das wollte dieser nicht hinnehmen, die Verstöße mit den drei auf ihn zugelassenen Fahrzeugen hätten andere Personen begangen. Gegen die Entscheidungen habe er lediglich kein Rechtsmittel eingelegt um der Behörde Arbeit zu ersparen. Die Verhängung einer Fahrtenbuchauflage als milderes Mittel hätte zunächst greifen sollen – er sei beruflich auf die Fahrerlaubnis angewiesen.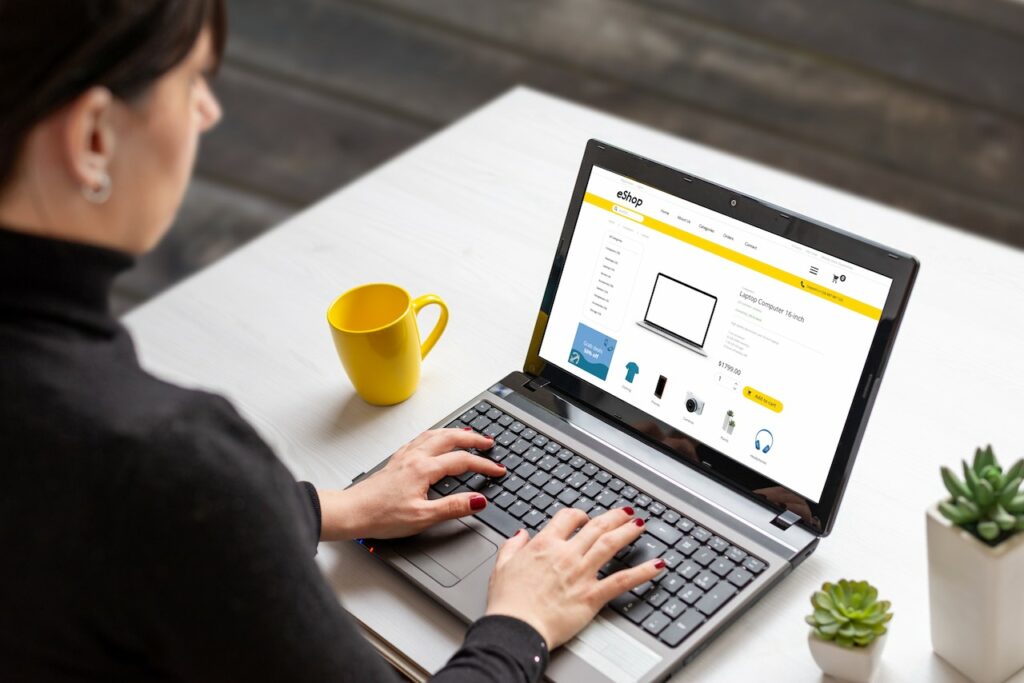
 Aus diesem Grund habe für den Beklagten eine klare Situation vorgelegen, so dass er nicht zum Überholen des Radfahrers hätte ansetzen dürfen. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Berufung der Beklagten beim OLG.
Aus diesem Grund habe für den Beklagten eine klare Situation vorgelegen, so dass er nicht zum Überholen des Radfahrers hätte ansetzen dürfen. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Berufung der Beklagten beim OLG.
