Wann genau gilt eine Pflicht für einen Winterdienst mit Räumen und Streuen? Ist auch eine lokale Glätte bereits ein Kriterium und kann eine Missachtung mit Folgen für daraufhin durch Stürze verletzte Bürger gar zu Schmerzensgeldansprüchen führen? Eine allgemeine Glättegefahr sei nicht Voraussetzung für Winterdienstpflicht, befand jedenfalls das Berliner Kammergericht im Dezember 2022.
Die winterliche Räum- und Streupflicht gelte nicht erst dann, wenn eine allgemeine Glätte vorliegt, sondern bereits bei einer ernsthaften lokalen Glätte. Dies gelte auch für einen Dritten, der die Winterdienstpflicht für den primär Verantwortlichen übernommen hat, so die Entscheidung des Kammergericht.
Wie kam es zu diesem Urteil? Gegen 11 Uhr an einem Tag im Dezember 2020 kam eine etwa 69-jährige Frau auf einem Klinikgelände in Berlin wegen Glatteises zu Fall und verletzte sich. Das gesamte Gelände war wegen Glätte rutschig und nicht gestreut worden, wobei die Winterdienstpflicht war auf eine Firma übertragen worden war. Die Frau klagte gegen die Trägerin der Klinik und die Winterdienstfirma auf Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro.
 Das zunächst angerufene Landgericht Berlin wies die Klage ab. Seiner Auffassung nach komme allein eine Haftung der Winterdienstfirma in Betracht. Eine Haftung sei aber ausgeschlossen, da die Klägerin nicht dargelegt habe, dass am Unfalltag allgemeine Glättegefahr in Berlin herrschte und für die Beklagte konkrete Anhaltspunkte für eine Gefahr aufgrund einzelner Glättestellen bestanden habe.
Das zunächst angerufene Landgericht Berlin wies die Klage ab. Seiner Auffassung nach komme allein eine Haftung der Winterdienstfirma in Betracht. Eine Haftung sei aber ausgeschlossen, da die Klägerin nicht dargelegt habe, dass am Unfalltag allgemeine Glättegefahr in Berlin herrschte und für die Beklagte konkrete Anhaltspunkte für eine Gefahr aufgrund einzelner Glättestellen bestanden habe.
Das Kammergericht in der nächsten Instanz erkannte, dass der Frau ein Anspruch auf Schmerzensgeld zustehe. Die beklagte Winterdienstfirma habe die Verkehrssicherungspflicht verletzt. Es komme dabei nicht darauf an, ob eine allgemeine Glätte herrschte. Denn die Beweisaufnahme habe gezeigt, dass seit gut 9 Uhr an diesem Tag bis zum Unfallzeitpunkt das Gelände der Klinik verreist und deshalb sehr rutschig war. Die Beklagte hätte daher spätestens um 10 Uhr streuen müssen.
Von dem beklagten Winterdienst könne sicher nicht verlangt werden, an einem Tag, an dem keine allgemeine Glätte herrscht, sämtliche Flächen in ihrem Winterdienstgebiet vorsorglich auf ernsthafte lokale Glättegefahren hin zu kontrollieren. Dies sei für den vorliegenden Fall aber unerheblich. Denn die primär Streupflichtige vor Ort hätte spätestens um 10 Uhr auf die ernsthafte Glättegefahr reagieren müssen und die Firma benachrichtigen.
Das Kammergericht erkannte darüber hinaus ein Schmerzensgeld in Höhe von 5.000 € für angemessen, da die Klägerin für mehrere Tage über Weihnachten in ambulanter Behandlung war, sich operieren lassen musste und danach über mehrere Monate einen schwierigen Heilungsverlauf erdulden musste. Sie musste sich zudem Reha-Maßnahmen unterziehen und war über mehrere Wochen auf eine Gehhilfe angewiesen.
Kammergericht Berlin, Urteil vom 6.12.2022; AZ – 21 U 56/22 –
Foto: Jan


 Die Kläger wenden sich nicht gegen die Beurteilung des Landgerichts, wonach sich das Unterlassungsbegehren nicht auf eine Gesundheitsverletzung stützen lässt. Diese Beurteilung sei rechtlich auch nicht zu beanstanden. Sie nahmen auch die Annahme des Landgerichts hin, dass der beklagten Spedition keine wesentliche Beeinträchtigung der Benutzung zuzurechnen sei. Auch insoweit sind Rechtsfehler des Landgerichts nicht ersichtlich.
Die Kläger wenden sich nicht gegen die Beurteilung des Landgerichts, wonach sich das Unterlassungsbegehren nicht auf eine Gesundheitsverletzung stützen lässt. Diese Beurteilung sei rechtlich auch nicht zu beanstanden. Sie nahmen auch die Annahme des Landgerichts hin, dass der beklagten Spedition keine wesentliche Beeinträchtigung der Benutzung zuzurechnen sei. Auch insoweit sind Rechtsfehler des Landgerichts nicht ersichtlich. In dem zugrunde liegenden Fall hatten die Eigentümer einer Wohnung in Berlin durch Umbaumaßnahmen den Spitzboden in ihre Wohnung integriert. Dagegen klagte die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) – und verlangte den Rückbau. Das Landgericht Berlin entschied tatsächlich auch zu Gunsten der Klägerin und untersagte den Ausbau. Ihr stehe im Gegenteil ein Anspruch auf Rückbau der Umbaumaßnahmen zu.
In dem zugrunde liegenden Fall hatten die Eigentümer einer Wohnung in Berlin durch Umbaumaßnahmen den Spitzboden in ihre Wohnung integriert. Dagegen klagte die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) – und verlangte den Rückbau. Das Landgericht Berlin entschied tatsächlich auch zu Gunsten der Klägerin und untersagte den Ausbau. Ihr stehe im Gegenteil ein Anspruch auf Rückbau der Umbaumaßnahmen zu. Webseiten-Betreiber können dem entgegenwirken, indem sie solche Google-Fonts direkt einbinden. Das funktioniert letztlich in gleicher Weise wie der Google-Dienst.
Webseiten-Betreiber können dem entgegenwirken, indem sie solche Google-Fonts direkt einbinden. Das funktioniert letztlich in gleicher Weise wie der Google-Dienst.  Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin blieb ohne Erfolg. Die Richter am Oberverwaltungsgericht in Münster argumentierten, dass der Einwand der Antragstellerin, die unbedingt zu prüfenden Belange des Wohls der beiden Tiere, seien nicht hinreichend berücksichtigt worden, sei unzutreffend. Die Antragstellerin habe keinerlei Gesichtspunkte aufgezeigt, dass die Haltung von Hängebauchschweinen eine in einem Wohngebiet zulässige Kleintierhaltung sei. Ob die Haltung der Schweine durch die Antragstellerin tatsächlich zu einer Belästigung der Nachbarn durch Gerüche führt, sei denn auch unerheblich.
Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin blieb ohne Erfolg. Die Richter am Oberverwaltungsgericht in Münster argumentierten, dass der Einwand der Antragstellerin, die unbedingt zu prüfenden Belange des Wohls der beiden Tiere, seien nicht hinreichend berücksichtigt worden, sei unzutreffend. Die Antragstellerin habe keinerlei Gesichtspunkte aufgezeigt, dass die Haltung von Hängebauchschweinen eine in einem Wohngebiet zulässige Kleintierhaltung sei. Ob die Haltung der Schweine durch die Antragstellerin tatsächlich zu einer Belästigung der Nachbarn durch Gerüche führt, sei denn auch unerheblich. Das wollte dieser nicht hinnehmen, die Verstöße mit den drei auf ihn zugelassenen Fahrzeugen hätten andere Personen begangen. Gegen die Entscheidungen habe er lediglich kein Rechtsmittel eingelegt um der Behörde Arbeit zu ersparen. Die Verhängung einer Fahrtenbuchauflage als milderes Mittel hätte zunächst greifen sollen – er sei beruflich auf die Fahrerlaubnis angewiesen.
Das wollte dieser nicht hinnehmen, die Verstöße mit den drei auf ihn zugelassenen Fahrzeugen hätten andere Personen begangen. Gegen die Entscheidungen habe er lediglich kein Rechtsmittel eingelegt um der Behörde Arbeit zu ersparen. Die Verhängung einer Fahrtenbuchauflage als milderes Mittel hätte zunächst greifen sollen – er sei beruflich auf die Fahrerlaubnis angewiesen.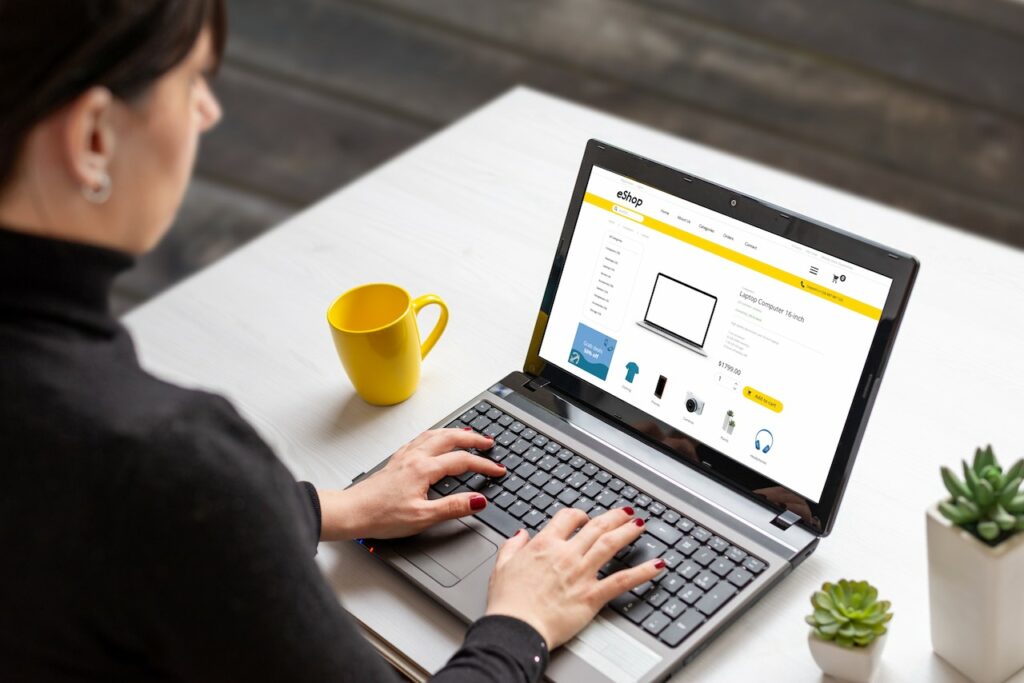
 Aus diesem Grund habe für den Beklagten eine klare Situation vorgelegen, so dass er nicht zum Überholen des Radfahrers hätte ansetzen dürfen. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Berufung der Beklagten beim OLG.
Aus diesem Grund habe für den Beklagten eine klare Situation vorgelegen, so dass er nicht zum Überholen des Radfahrers hätte ansetzen dürfen. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Berufung der Beklagten beim OLG.