Für ein klares Arbeitsverhältnis spricht es, wenn ein Auftraggeber die Zusammenarbeit über die von ihm betriebene Online-Plattform so steuert, dass ein Auftragnehmer infolge dessen seine Tätigkeit nach Ort, Zeit und Inhalt nicht frei gestalten kann.
Der spätere Kläger war eine Zeit lang regelmäßig für das Online-Unternehmen im Einsatz war und bekam dann die Information, dass ihm keine weiteren Aufträge mehr angeboten würden. Mit seiner daraufhin einlegten Klage hatte er zunächst die Feststellung beantragt, dass inzwischen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bestände. Im Verlauf des Rechtsstreits kündigte das Unternehmen vorsorglich ein etwaig bestehendes Arbeitsverhältnis. Daraufhin hatte der Mann seine Klage – mit der er außerdem Vergütungsansprüche verfolgte – um einen Kündigungsschutzantrag erweitert.
Das Bundesarbeitsgereicht hat Anfang Dezember 2020 entschieden, dass die tatsächliche Durchführung von Kleinstaufträgen („Mikrojobs“) durch Nutzer einer Online-Plattform (er wird damit zum sogenannten „Crowdworker“) auf der Grundlage einer mit deren Betreiber (“Crowdsourcer”) getroffenen Rahmenvereinbarung ergeben kann, dass die rechtliche Beziehung zwischen beiden als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren ist. Die zuvor damit befassten Gerichte hatten noch im Sinne der Online-Plattform entschieden.
 Wie siehen diese Mikrojobs aus? Über einen persönlich eingerichteten Account kann jeder Nutzer der Online-Plattform auf bestimmte Verkaufsstellen bezogene Aufträge annehmen – ohne dazu vertraglich verpflichtet zu sein. Übernehmen Crowdworker einen Auftrag, müssen diese regelmäßig binnen zwei Stunden nach detaillierten Vorgaben der Plattform, des „Crowdsourcers“, erledigen. Für erledigte Aufträge werden auf dem Nutzerkonto Erfahrungspunkte gutgeschrieben. Das System erhöht mit der Anzahl erledigter Aufträge das Level und gestattet die gleichzeitige Annahme mehrerer Aufträge. Der Kläger selbst führte so für die Beklagte 2.978 Aufträge in einem Zeitraum von elf Monaten aus.
Wie siehen diese Mikrojobs aus? Über einen persönlich eingerichteten Account kann jeder Nutzer der Online-Plattform auf bestimmte Verkaufsstellen bezogene Aufträge annehmen – ohne dazu vertraglich verpflichtet zu sein. Übernehmen Crowdworker einen Auftrag, müssen diese regelmäßig binnen zwei Stunden nach detaillierten Vorgaben der Plattform, des „Crowdsourcers“, erledigen. Für erledigte Aufträge werden auf dem Nutzerkonto Erfahrungspunkte gutgeschrieben. Das System erhöht mit der Anzahl erledigter Aufträge das Level und gestattet die gleichzeitige Annahme mehrerer Aufträge. Der Kläger selbst führte so für die Beklagte 2.978 Aufträge in einem Zeitraum von elf Monaten aus.
Das BAG sah die Argumente klar im Sinne des Klägers: Dieser leistete in arbeitnehmertypischer Weise weisungsgebundene und fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Zwar war er vertraglich nicht zur Annahme von Angeboten der beklagten Plattform verpflichtet. Die Organisationsstruktur des Crowdsourcing-Unternehmens war aber klar darauf ausgerichtet, dass über einen Account angemeldete und eingearbeitete Nutzer kontinuierlich, Schritt für Schritt, vertraglich vorgegebener Kleinstaufträge annehmen, um diese persönlich zu erledigen.
Einschränkend hat das Gericht allerdings auch festgestellt, dass der Kläger nicht ohne weiteres eine Gehaltszahlung in Höhe einer bisher als vermeintlich freie Mitarbeiter bezogene Honorare verlangen kann. Stellt sich ein solches freies Dienstverhältnis im Nachhinein als Arbeitsverhältnis dar, kann in der Regel nicht davon ausgegangen werden, dass die für den freien Mitarbeiter vereinbarte Vergütung der Höhe nach auch für eine Beschäftigung als Arbeitnehmer verabredet sei.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 1.12.2020; AZ – 9 AZR 102/70 –
Foto: DURIS Guillaume

 Das sah das Landgericht Berlin in seinem Urteil vom Juni 2019 anders. Bloßes Schweigen des Vermieters auf eine Terminanfrage des Mieters sei nicht ausreichend, eine Verweigerung als gegeben zu begründen. Grundsätzlich müsse nämlich der Vermieter aufgrund eines entsprechenden Schreiben nicht von sich aus tätig werden. Entscheidend sei, dass es sich bei einer Belegeinsicht nicht um eine Bringschuld des Vermieters handele.
Das sah das Landgericht Berlin in seinem Urteil vom Juni 2019 anders. Bloßes Schweigen des Vermieters auf eine Terminanfrage des Mieters sei nicht ausreichend, eine Verweigerung als gegeben zu begründen. Grundsätzlich müsse nämlich der Vermieter aufgrund eines entsprechenden Schreiben nicht von sich aus tätig werden. Entscheidend sei, dass es sich bei einer Belegeinsicht nicht um eine Bringschuld des Vermieters handele. Im realen Leben existieren die Zahlungsprobleme aber so oder so. Als Vermieter könnte daher etwa eine Mietminderung helfen, ein langfristiges Mietverhältnis weiterhin aufrecht zu erhalten. In Betracht kommen daher eine Stundung der Mietzahlungen, eine temporäre Herabsetzung der Miete, eventuell kombiniert mit Staffel- oder Umsatzmietvereinbarungen oder der Vereinbarung zusätzlicher Mietsicherheiten (zum Beispiel Konzernbürgschaften). Solche Maßnahmen sollten in einem ordnungsgemäßen Nachtrag zum Mietvertrag dokumentiert werden. Eine Stundungsabrede etwa, betrifft denn auch nicht nur die Mietzahlungsmodalitäten – die ja gegebenenfalls für einen kurzen Zeitraum auch außerhalb eines Nachtrages angepasst werden könnte –, sondern schränkt auch das Recht des Vermieters zur außerordentlichen Kündigung des Mietvertrages zumindest temporär ein.
Im realen Leben existieren die Zahlungsprobleme aber so oder so. Als Vermieter könnte daher etwa eine Mietminderung helfen, ein langfristiges Mietverhältnis weiterhin aufrecht zu erhalten. In Betracht kommen daher eine Stundung der Mietzahlungen, eine temporäre Herabsetzung der Miete, eventuell kombiniert mit Staffel- oder Umsatzmietvereinbarungen oder der Vereinbarung zusätzlicher Mietsicherheiten (zum Beispiel Konzernbürgschaften). Solche Maßnahmen sollten in einem ordnungsgemäßen Nachtrag zum Mietvertrag dokumentiert werden. Eine Stundungsabrede etwa, betrifft denn auch nicht nur die Mietzahlungsmodalitäten – die ja gegebenenfalls für einen kurzen Zeitraum auch außerhalb eines Nachtrages angepasst werden könnte –, sondern schränkt auch das Recht des Vermieters zur außerordentlichen Kündigung des Mietvertrages zumindest temporär ein. Die an diesem Tag handschriftlich auf der Fotokopie erstellten Ergänzungen und Durchstreichungen stellen im Zusammenhang mit dem Originaltestament ein formwirksames Testament dar, denn die formwirksame Erstellung eines eigenhändig geschriebenen ordentlichen Testaments muss weder in einem einheitlichen Akt noch in einer einzigen Urkunde erfolgen. Das in diesem Fall ersichtliche eigenhändige Durchstreichen war sowohl nach dem äußeren Schriftbild der Urkunde als auch in der bestätigenden Änderung des Testaments deutlich und ist rechtlich nicht zu beanstanden, so das Gericht.
Die an diesem Tag handschriftlich auf der Fotokopie erstellten Ergänzungen und Durchstreichungen stellen im Zusammenhang mit dem Originaltestament ein formwirksames Testament dar, denn die formwirksame Erstellung eines eigenhändig geschriebenen ordentlichen Testaments muss weder in einem einheitlichen Akt noch in einer einzigen Urkunde erfolgen. Das in diesem Fall ersichtliche eigenhändige Durchstreichen war sowohl nach dem äußeren Schriftbild der Urkunde als auch in der bestätigenden Änderung des Testaments deutlich und ist rechtlich nicht zu beanstanden, so das Gericht. Das Oberlandesgericht Hamburg bestätigte die Entscheidung des Amtsgerichts und entschied, dass die Antragstellerin nicht Alleinerbin des Erblassers sei. Zwei Aufkleber auf ein Fotoumschlag stellten kein wirksames Testament dar. Es lägen deutliche Zweifel an dem Testierwillen vor, auch wenn grundsätzlich die Wirksamkeit eines Testament nicht voraussetzt, dass dies ausdrücklich als solches bezeichnet wird. Auch ein ungewöhnliches Schreibmaterial oder eine ungewöhnliche Gestaltung stehe der Wirksamkeit nicht entgegen.
Das Oberlandesgericht Hamburg bestätigte die Entscheidung des Amtsgerichts und entschied, dass die Antragstellerin nicht Alleinerbin des Erblassers sei. Zwei Aufkleber auf ein Fotoumschlag stellten kein wirksames Testament dar. Es lägen deutliche Zweifel an dem Testierwillen vor, auch wenn grundsätzlich die Wirksamkeit eines Testament nicht voraussetzt, dass dies ausdrücklich als solches bezeichnet wird. Auch ein ungewöhnliches Schreibmaterial oder eine ungewöhnliche Gestaltung stehe der Wirksamkeit nicht entgegen. Cookies sind individuell vergebene Kennungen, die primär der Wiedererkennung eines Endgerätes dienen. Cookies ermöglichen beispielsweise, dass sich ein Nutzer in einem Online-Shop nicht auf jeder Artikelseite immer wieder neu einloggen muss. Neben solchen, für das Funktionieren von Webseiten essentiellen Cookies werden die kleinen Textdateien jedoch mitunter auf dem Endgerät des Nutzers platziert, um ihn für Werbetreibende zu identifizieren. Große Tracking-Anbieter wie Google Analytics nutzen Cookies, um den Nutzer über verschiedene Webseiten hinweg wiederzuerkennen und auf diese Weise ein Werbeprofil jedes Nutzers zu erstellen.
Cookies sind individuell vergebene Kennungen, die primär der Wiedererkennung eines Endgerätes dienen. Cookies ermöglichen beispielsweise, dass sich ein Nutzer in einem Online-Shop nicht auf jeder Artikelseite immer wieder neu einloggen muss. Neben solchen, für das Funktionieren von Webseiten essentiellen Cookies werden die kleinen Textdateien jedoch mitunter auf dem Endgerät des Nutzers platziert, um ihn für Werbetreibende zu identifizieren. Große Tracking-Anbieter wie Google Analytics nutzen Cookies, um den Nutzer über verschiedene Webseiten hinweg wiederzuerkennen und auf diese Weise ein Werbeprofil jedes Nutzers zu erstellen. Grundsätzlich sollen Mieterhöhungen bei Wohnungen, für die es einen Mietspiegel gibt, dann nur noch mit genau diesem Mietspiegel oder aber einem Sachverständigengutachten begründet werden dürfen. Bisher können sich die Vermieter auch auf Vergleichswohnungen beziehen, was immer wieder zu Streitigkeiten führte. Diese qualifizierten Mietspiegel sollen allerspätestens alle fünf Jahren neu erstellt werden.
Grundsätzlich sollen Mieterhöhungen bei Wohnungen, für die es einen Mietspiegel gibt, dann nur noch mit genau diesem Mietspiegel oder aber einem Sachverständigengutachten begründet werden dürfen. Bisher können sich die Vermieter auch auf Vergleichswohnungen beziehen, was immer wieder zu Streitigkeiten führte. Diese qualifizierten Mietspiegel sollen allerspätestens alle fünf Jahren neu erstellt werden. Eigentümer der im Nachlass benannten Immobilie werden dann die gesetzlichen Erben (in der Regel Kinder und Ehegatte) – entsprechend ihrer Quote. Sind mehrere Erben vorhanden, entsteht eine so genannte Erbengemeinschaft. Diese ist gesetzlich auf Auseinandersetzung gerichtet, was bei Streitigkeiten zwischen den Miterben dazu führt, dass die Immobilie oft verkauft werden muss. Grund ist, dass die Erbengemeinschaft nur gemeinschaftlich handeln kann. Liegt hingegen ein Testament vor, so fällt die Immobilie den darin eingesetzten Erben zu. Sofern der Erblasser das Haus oder die Wohnung aber im Testament nicht einem bestimmten Erben übertragen hat, entsteht auch in diesem Fall eine Erbengemeinschaft.
Eigentümer der im Nachlass benannten Immobilie werden dann die gesetzlichen Erben (in der Regel Kinder und Ehegatte) – entsprechend ihrer Quote. Sind mehrere Erben vorhanden, entsteht eine so genannte Erbengemeinschaft. Diese ist gesetzlich auf Auseinandersetzung gerichtet, was bei Streitigkeiten zwischen den Miterben dazu führt, dass die Immobilie oft verkauft werden muss. Grund ist, dass die Erbengemeinschaft nur gemeinschaftlich handeln kann. Liegt hingegen ein Testament vor, so fällt die Immobilie den darin eingesetzten Erben zu. Sofern der Erblasser das Haus oder die Wohnung aber im Testament nicht einem bestimmten Erben übertragen hat, entsteht auch in diesem Fall eine Erbengemeinschaft. Wurden Pflichtteilsberechtigte durch den Erblasser enterbt oder durch eine letztwillige Verfügung unter die Höhe des Pflichtteils gesetzt, so erhalten sie ihren Anspruch darauf. Aber auch Schenkungen aus dem Vermögen der Verstorbenen, die innerhalb der letzten zehn Jahre zuvor getätigt wurden, können einen Pflichtteilsanspruch entstehen lassen – eben, wenn unter fiktiver Hinzurechnung des Schenkungswerts die Höhe des Erbes die Höhe des Pflichtteils nicht mehr erreicht.
Wurden Pflichtteilsberechtigte durch den Erblasser enterbt oder durch eine letztwillige Verfügung unter die Höhe des Pflichtteils gesetzt, so erhalten sie ihren Anspruch darauf. Aber auch Schenkungen aus dem Vermögen der Verstorbenen, die innerhalb der letzten zehn Jahre zuvor getätigt wurden, können einen Pflichtteilsanspruch entstehen lassen – eben, wenn unter fiktiver Hinzurechnung des Schenkungswerts die Höhe des Erbes die Höhe des Pflichtteils nicht mehr erreicht.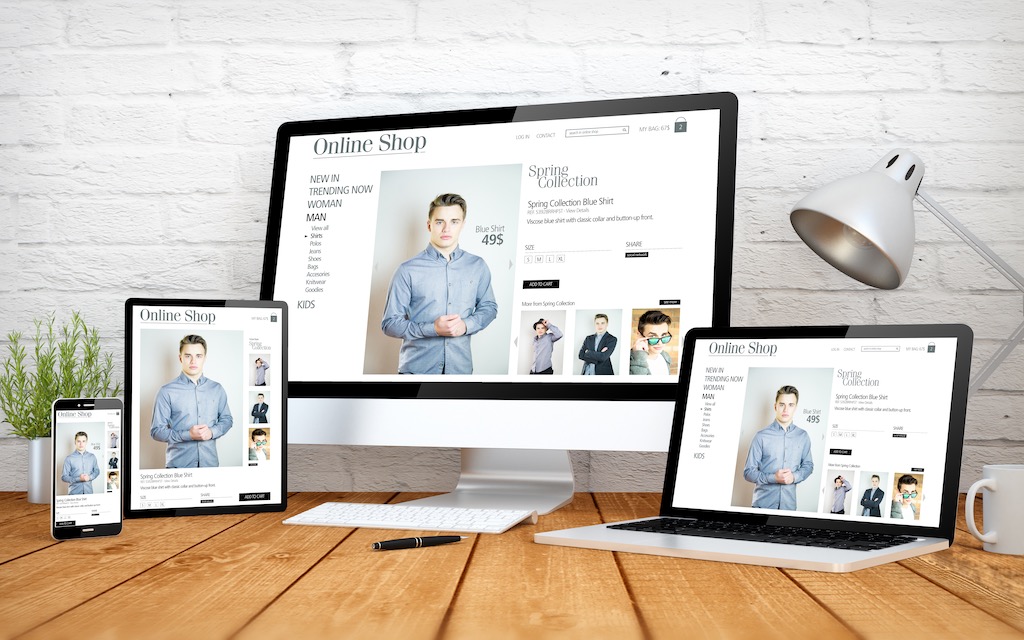 Im Fall des OLG Hamm ging es um eine Abmahnung und anschließende Klage des Mitbewerbers eines Online-Händler, der auf „Amazon“ Taschenmesser der Herstellers Victorinox angeboten. Victorinox wiederum gewährt eine (teilweise) zeitlich unbeschränkte, sogenannte Victorinox-Garantie. Der Händler hatte diese Garantie nicht weiter beworben, sondern lediglich in einem Untermenü der Angebotsseite den Hyperlink „Weitere technische Informationen“ eingebettet. Bei dessen Anklicken wurde das auf Amazon als PDF-Datei gespeicherte Informationsblatt des Herstellers geöffnet. Dazu müssten, dem Urteil nach, Angaben kommen, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, doch die waren eben so wenig enthalten, wie der Hinweis auf die davon unabhängigen gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Im Fall des OLG Hamm ging es um eine Abmahnung und anschließende Klage des Mitbewerbers eines Online-Händler, der auf „Amazon“ Taschenmesser der Herstellers Victorinox angeboten. Victorinox wiederum gewährt eine (teilweise) zeitlich unbeschränkte, sogenannte Victorinox-Garantie. Der Händler hatte diese Garantie nicht weiter beworben, sondern lediglich in einem Untermenü der Angebotsseite den Hyperlink „Weitere technische Informationen“ eingebettet. Bei dessen Anklicken wurde das auf Amazon als PDF-Datei gespeicherte Informationsblatt des Herstellers geöffnet. Dazu müssten, dem Urteil nach, Angaben kommen, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, doch die waren eben so wenig enthalten, wie der Hinweis auf die davon unabhängigen gesetzlichen Gewährleistungsrechte.