Die Geschwindigkeitsbegrenzung für Elektroautos beschäftigt viele Fahrerinnen und Fahrer dieser emissionsfreien Fahrzeuge: Muss, wer keinerlei Stickstoffdioxid ausstößt, trotzdem Tempo-30-Zonen respektieren, die aus Gründen der Luftreinhaltung entstanden? Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat im Juli 2025 klar entschieden, dass dies der Fall ist – und damit die Klage eines Düsseldorfer Bürgers vollständig abgewiesen.
Ausgangspunkt des Verfahrens war die Merowingerstraße im Stadtteil Bilk. Dort gilt zwischen der Kopernikusstraße und dem Ludwig-Hammers-Platz eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Stadt Düsseldorf richtete diese Beschränkung nicht aus Verkehrssicherheitsgründen ein, sondern ausdrücklich zur Senkung der Stickstoffdioxidbelastung. Grundlage dafür ist der Luftreinhalteplan Düsseldorf 2022, den die Bezirksregierung Düsseldorf für das gesamte Stadtgebiet aufstellte.
Ein in Bilk wohnhafter Bürger wollte die Verkehrsschilder abmontieren lassen. Er argumentierte, die Beschränkung habe ihre Grundlage verloren, weil die tatsächlichen Messwerte auf der Merowingerstraße längst deutlich unter 40 Mikrogramm pro Kubikmeter lagen. Zudem fahre er ein Elektroauto und stoße selbst gar kein Stickstoffdioxid aus – weshalb ihm eine Ausnahme zustehe.
Das Gericht folgte beiden Argumenten nicht. Den gesunkenen Messwerten maß es keine Bedeutung bei, die gegen die Beschränkung spräche – im Gegenteil: Wer feststellt, dass die Werte sinken, bestätigt damit gerade die Wirksamkeit der Maßnahme, nicht deren Überflüssigkeit. Hinzu kommt, dass die neue EU-Luftqualitätsrichtlinie ab 2026 Verpflichtungen mit sich bringt, damit Deutschland ab 2030 einen noch strengeren Grenzwert von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter für Stickstoffdioxid einhält. Angesichts dieser absehbaren Verschärfung besteht kein Anlass, die bestehende Maßnahme bereits jetzt zu beenden. 
Der Luftreinhalteplan selbst hielt einer kritischen Überprüfung stand: Die Prognosen zur Merowingerstraße entstanden methodisch korrekt und stützen sich auf realistische Grundannahmen. Das Gericht fand das Prognose-Ergebnis inhaltlich schlüssig begründet. Für einzelne Bürger ist ein solcher Plan ohnehin kein direkter Angriffspunkt – er bindet die Verwaltung als Planungsgrundlage, ermöglicht aber keine unmittelbare Klage dagegen. Das Gericht nutzte das vorliegende Verfahren, um den Plan gleichsam als Nebenfrage zu überprüfen – also obwohl er nicht selbst Klagegegenstand war – und kam dabei zu keinen Beanstandungen.
Besonders bemerkenswert ist die Haltung des Gerichts zur Elektroauto-Frage. Es erkannte zwar an, dass ein Elektrofahrzeug tatsächlich kein Stickstoffdioxid emittiert. Eine Ausnahmeregelung hielt es dennoch für unverhältnismäßig – und stützte sich dabei auf konkrete Erfahrungen aus der Vergangenheit: Die früheren Umweltspuren in Düsseldorf hatten gezeigt, dass Sonderregelungen für bestimmte Fahrzeugkategorien Rückstaus erzeugen können. Ein solcher Stau würde die angestrebte Verflüssigung des Verkehrs untergraben oder sogar ins Gegenteil verkehren. Stockender Verkehr erhöht schließlich die Emissionen aller anderen Fahrzeuge und verschlechtert damit die Luftqualität insgesamt. Eine Ausnahme für Elektroautos wäre unter diesem Gesichtspunkt letztlich kontraproduktiv – weshalb der Luftreinhalteplan eine solche Ausnahme nicht vorzusehen brauchte.
Das Urteil verdeutlicht, wie weitreichend Luftreinhaltepläne als Planungsinstrumente wirken. Sie schaffen eine Grundlage, auf der Kommunen Verkehrsbeschränkungen erlassen, die auch emissionsarme Fahrzeuge erfassen. Wer auf einer entsprechend ausgeschilderten Strecke fährt, muss die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung einhalten – unabhängig davon, welche Antriebstechnik das Fahrzeug nutzt. Für eine erfolgreiche gerichtliche Anfechtung reicht es nicht, auf gesunkene Schadstoffwerte zu verweisen, solange der Plan methodisch trägt und aktuelle Verpflichtungen aus dem EU-Recht eine Beibehaltung der Maßnahme rechtfertigen.
Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 1.7.2025; AZ – 3 K 1482/22 –
Foto: philipk76




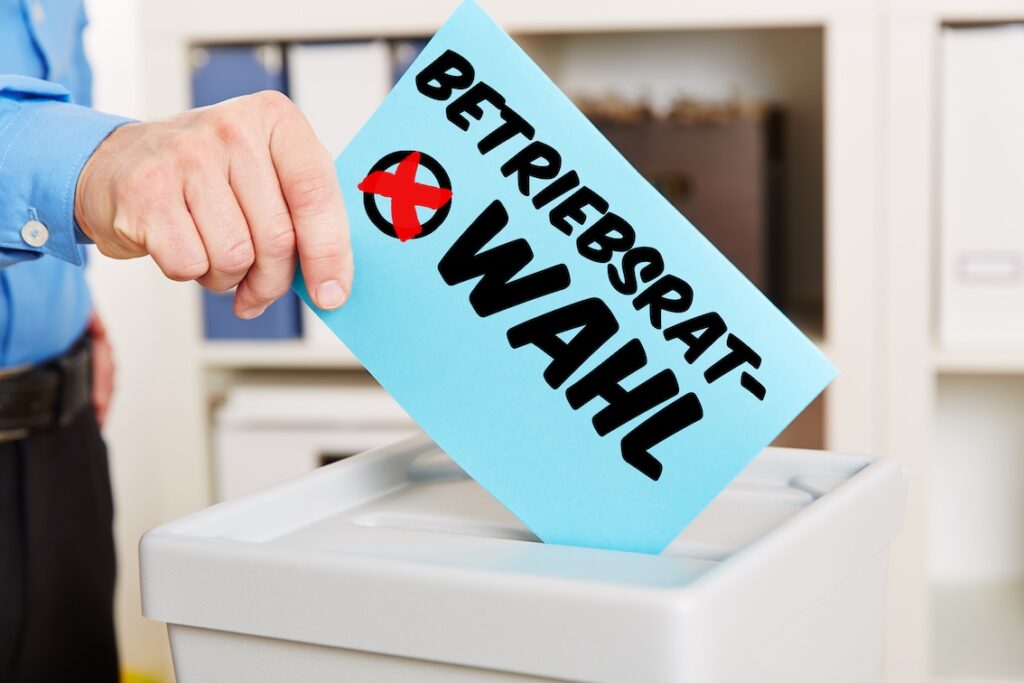


 Besonders bedeutsam erscheint die Feststellung des Gerichts zur Unerheblichkeit eines möglicherweise bestehenden Gestattungs-Anspruchs. Der Gesetzgeber hat bewusst festgelegt, dass jede beabsichtigte Änderung am Gemeinschaftseigentum eines legitimierenden Beschlusses bedarf. Dieser Beschluss lässt sich notfalls gerichtlich durchsetzen. Würde man den Einwand eines bestehenden Anspruchs auf Genehmigung zulassen, würde dies dem eindeutigen gesetzgeberischen Willen widersprechen. Bedeutet: Wer sich über das vorgegebene Verfahren hinwegsetzt, muss nach der gesetzlichen Konzeption die Konsequenzen tragen.
Besonders bedeutsam erscheint die Feststellung des Gerichts zur Unerheblichkeit eines möglicherweise bestehenden Gestattungs-Anspruchs. Der Gesetzgeber hat bewusst festgelegt, dass jede beabsichtigte Änderung am Gemeinschaftseigentum eines legitimierenden Beschlusses bedarf. Dieser Beschluss lässt sich notfalls gerichtlich durchsetzen. Würde man den Einwand eines bestehenden Anspruchs auf Genehmigung zulassen, würde dies dem eindeutigen gesetzgeberischen Willen widersprechen. Bedeutet: Wer sich über das vorgegebene Verfahren hinwegsetzt, muss nach der gesetzlichen Konzeption die Konsequenzen tragen.
