Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 10. Juli 2024 eine grundlegende Entscheidung zur steuerlichen Behandlung von Sterbegeldversicherungen getroffen. Das Urteil befasst sich mit der Frage, wie Leistungen aus einer Sterbegeldversicherung und die damit verbundenen Bestattungskosten erbschaftsteuerlich zu bewerten sind. Der Fall betraf einen Kläger und seine Schwester, die ihre Tante beerbt hatten. Die Erblasserin hatte eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen und das Bezugsrecht für die Versicherungssumme bereits zu Lebzeiten an ein Bestattungsunternehmen abgetreten. Nach ihrem Tod stellte das Bestattungsunternehmen 11.653,96 Euro für die durchgeführte Bestattung in Rechnung. Die Sterbegeldversicherung übernahm davon einen Betrag von 6.864,82 Euro.
Das Finanzamt behandelte den gewährten Sachleistungsanspruch als Teil des Nachlasses und erhöhte entsprechend die Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteuer um 6.864 Euro. Für die geltend gemachten Nachlassverbindlichkeiten – zu denen auch die Bestattungskosten zählten – berücksichtigte das Finanzamt lediglich die gesetzliche Pauschale für Erbfallkosten in Höhe von 10.300 Euro. Nach einem erfolglosen Einspruchsverfahren und einer abgewiesenen Klage vor dem Finanzgericht legte der Erbe Revision beim Bundesfinanzhof ein. Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an das Finanzgericht zurück.
 In seiner Entscheidung bestätigte der BFH zunächst die Position des Finanzgerichts, dass der durch die Sterbegeldversicherung erworbene Sachleistungsanspruch in den Nachlass fällt. Das hatte zu einer Erhöhung des Nachlassvermögens geführt, da die Erben einen wirtschaftlichen Vorteil in Form der Bestattungsleistungen erhielten. Daher war der Wert des Sachleistungsanspruchs aus der Sterbegeldversicherung in Höhe von 6.864,82 Euro bei der Bemessung der Erbschaftsteuer zu berücksichtigen.
In seiner Entscheidung bestätigte der BFH zunächst die Position des Finanzgerichts, dass der durch die Sterbegeldversicherung erworbene Sachleistungsanspruch in den Nachlass fällt. Das hatte zu einer Erhöhung des Nachlassvermögens geführt, da die Erben einen wirtschaftlichen Vorteil in Form der Bestattungsleistungen erhielten. Daher war der Wert des Sachleistungsanspruchs aus der Sterbegeldversicherung in Höhe von 6.864,82 Euro bei der Bemessung der Erbschaftsteuer zu berücksichtigen.
Der BFH stellte jedoch klar, dass die Bestattungskosten nicht nur in Höhe der gesetzlichen Pauschale abzugsfähig sind. Vielmehr müssen die tatsächlichen Aufwendungen für die Bestattung im vollen Umfang als Nachlassverbindlichkeiten steuermindernd berücksichtigt werden. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten teilweise durch Leistungen aus einer Sterbegeldversicherung gedeckt wurden. Die Entscheidung des BFH verdeutlicht: Einerseits erhöht der Sachleistungsanspruch aus der Sterbegeldversicherung den steuerpflichtigen Nachlass, andererseits sind die durch die Sterbegeldversicherung abgedeckten Bestattungskosten in voller Höhe als Nachlassverbindlichkeiten abzugsfähig.
Für die steuerliche Bewertung von Sterbegeldversicherungen bei Erbfällen bedeutet dies, dass eine differenzierte Betrachtung erforderlich ist. Der Abschluss einer Sterbegeldversicherung führt nicht zu einer steuerlichen Mehrbelastung, sofern die vollständige Abzugsfähigkeit der Bestattungskosten berücksichtigt wird. Besonders relevant wird diese Entscheidung, wenn die tatsächlichen Bestattungskosten die Pauschale von 10.300 Euro übersteigen.
Urteil der Bundesfinanzhof vom 10.7.2024; AZ – II 31/21 –
Foto: InsideCreativeHouse

 Die rechtliche Bewertung des Falls zeigt, dass Banken grundsätzlich unauthorisierte Abbuchungen erstatten müssen. Diese Erstattungspflicht entfällt jedoch bei grob fahrlässigem Verhalten des Kontoinhabers. Eine grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn grundlegende Sicherheitsvorkehrungen missachtet werden, die für jeden vernünftig denkenden Menschen erkennbar gewesen wären.
Die rechtliche Bewertung des Falls zeigt, dass Banken grundsätzlich unauthorisierte Abbuchungen erstatten müssen. Diese Erstattungspflicht entfällt jedoch bei grob fahrlässigem Verhalten des Kontoinhabers. Eine grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn grundlegende Sicherheitsvorkehrungen missachtet werden, die für jeden vernünftig denkenden Menschen erkennbar gewesen wären. Die rechtliche Auseinandersetzung entwickelte sich, als die Vermieterin von der ausgezogenen Mieterin rückständige Mietzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 einforderte. Das Gericht fällte eine grundlegende Entscheidung zum Mietvertragsende: Nach Auffassung der Richter endete das Mietverhältnis mit der ausgezogenen Mieterin aufgrund des Grundsatzes von Treu und Glauben.
Die rechtliche Auseinandersetzung entwickelte sich, als die Vermieterin von der ausgezogenen Mieterin rückständige Mietzahlungen für die Jahre 2022 und 2023 einforderte. Das Gericht fällte eine grundlegende Entscheidung zum Mietvertragsende: Nach Auffassung der Richter endete das Mietverhältnis mit der ausgezogenen Mieterin aufgrund des Grundsatzes von Treu und Glauben. Wurde die Wertminderung bisher auf Grundlage von Bruttoverkaufspreisen ermittelt, muss der entsprechende Umsatzsteueranteil vom errechneten Betrag abgezogen werden. Der Bundesgerichtshof will damit eine ungerechtfertigte finanzielle Besserstellung des Geschädigten vermeiden.
Wurde die Wertminderung bisher auf Grundlage von Bruttoverkaufspreisen ermittelt, muss der entsprechende Umsatzsteueranteil vom errechneten Betrag abgezogen werden. Der Bundesgerichtshof will damit eine ungerechtfertigte finanzielle Besserstellung des Geschädigten vermeiden.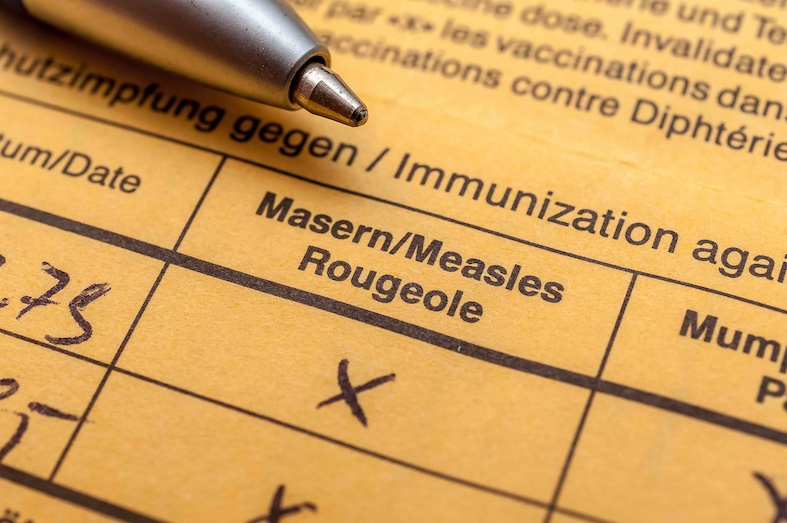 Eine Besonderheit ergibt sich aus dem Verhältnis von Schulpflicht und Masernimpfnachweis. Anders als bei Kindertagesstätten führt das Fehlen eines Nachweises nicht zum Ausschluss vom Unterricht. Die Gesundheitsämter können jedoch Bußgelder gegen die Erziehungsberechtigten verhängen. Die Höhe dieser Bußgelder bewegt sich meist zwischen 50 und 250 Euro, kann theoretisch aber bis zu 2.500 Euro betragen.
Eine Besonderheit ergibt sich aus dem Verhältnis von Schulpflicht und Masernimpfnachweis. Anders als bei Kindertagesstätten führt das Fehlen eines Nachweises nicht zum Ausschluss vom Unterricht. Die Gesundheitsämter können jedoch Bußgelder gegen die Erziehungsberechtigten verhängen. Die Höhe dieser Bußgelder bewegt sich meist zwischen 50 und 250 Euro, kann theoretisch aber bis zu 2.500 Euro betragen. Das Landesarbeitsgericht begründete seine Entscheidung mit dem Schutzzweck der gesetzlichen Regelungen. Diese sollen sicherstellen, dass der Anspruch auf den Mindesturlaub und dessen Abgeltung während des laufenden Arbeitsverhältnisses gewahrt bleiben. Eine Vereinbarung, die diese Ansprüche ausschließt oder beschränkt, würde den Schutzzweck verfehlen.
Das Landesarbeitsgericht begründete seine Entscheidung mit dem Schutzzweck der gesetzlichen Regelungen. Diese sollen sicherstellen, dass der Anspruch auf den Mindesturlaub und dessen Abgeltung während des laufenden Arbeitsverhältnisses gewahrt bleiben. Eine Vereinbarung, die diese Ansprüche ausschließt oder beschränkt, würde den Schutzzweck verfehlen. Diese Rechtsprechung berücksichtigt die gesellschaftliche Bedeutung der Elektromobilität. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur stellt einen wesentlichen Baustein für den Erfolg der Verkehrswende dar. Gleichzeitig wirft die Entscheidung ein Schlaglicht auf die Herausforderungen beim Infrastrukturausbau. Neben Lärmaspekten durch Kühlungsprozesse während der Ladevorgänge ergeben sich auch Fragen zur Parkraumsituation. E-Ladesäulen vor dem eigenen Haus sind damit ganz klar hinzunehmen.
Diese Rechtsprechung berücksichtigt die gesellschaftliche Bedeutung der Elektromobilität. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur stellt einen wesentlichen Baustein für den Erfolg der Verkehrswende dar. Gleichzeitig wirft die Entscheidung ein Schlaglicht auf die Herausforderungen beim Infrastrukturausbau. Neben Lärmaspekten durch Kühlungsprozesse während der Ladevorgänge ergeben sich auch Fragen zur Parkraumsituation. E-Ladesäulen vor dem eigenen Haus sind damit ganz klar hinzunehmen.
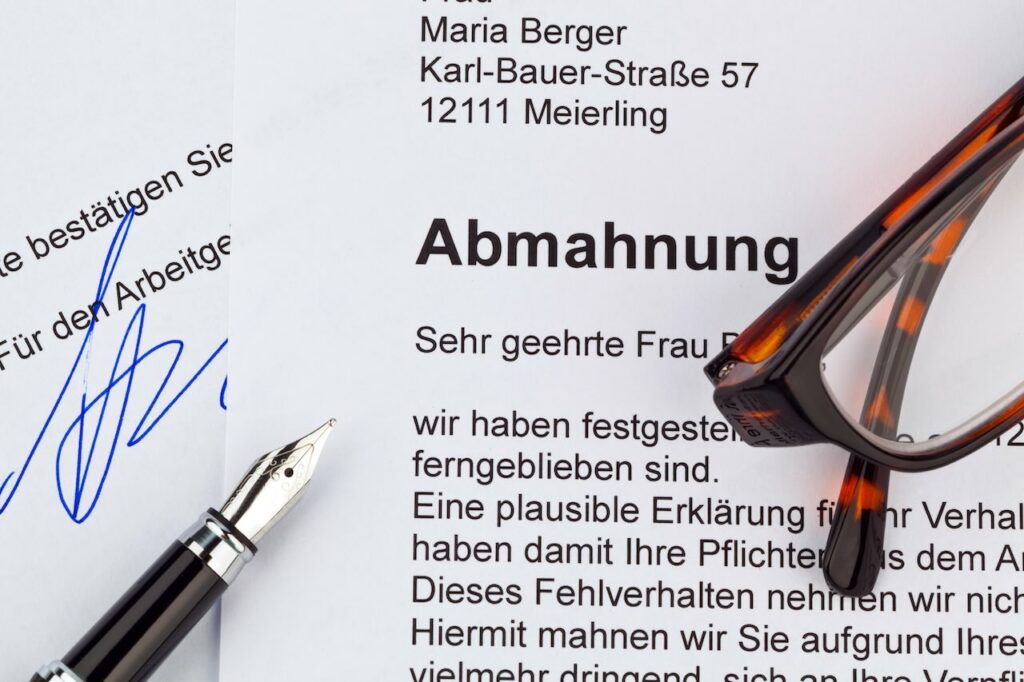 Besonders interessant ist die Bewertung des datenschutzrechtlichen Aspekts durch das Gericht. Bei Personalakten in Papierform greift die Datenschutzgrundverordnung nicht. Der Grund: Diese Verordnung bezieht sich ausschließlich auf strukturierte Dateisysteme. Konventionell geführte Akten, die nicht nach speziellen Kriterien geordnet sind, fallen nicht in ihren Anwendungsbereich.
Besonders interessant ist die Bewertung des datenschutzrechtlichen Aspekts durch das Gericht. Bei Personalakten in Papierform greift die Datenschutzgrundverordnung nicht. Der Grund: Diese Verordnung bezieht sich ausschließlich auf strukturierte Dateisysteme. Konventionell geführte Akten, die nicht nach speziellen Kriterien geordnet sind, fallen nicht in ihren Anwendungsbereich. Obwohl Familienhund sicher nicht als Sache behandelt werden sollte, wendete das Gericht die Regelungen zur Aufteilung des Hausrats auf diesen Fall an. Entscheidend für die Zuweisung war die Frage, wer die Hauptbezugsperson des Hundes ist und wer am besten für ein artgerechtes Umfeld sorgen kann. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Ehemann diese Kriterien am besten erfüllt. Er konnte gewährleisten, dass der Hund in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann. Besonders wichtig war dabei die Möglichkeit für den Hund, sich frei im Garten zu bewegen. Dies wurde als erheblicher Zugewinn an Lebensqualität für das Tier gewertet.
Obwohl Familienhund sicher nicht als Sache behandelt werden sollte, wendete das Gericht die Regelungen zur Aufteilung des Hausrats auf diesen Fall an. Entscheidend für die Zuweisung war die Frage, wer die Hauptbezugsperson des Hundes ist und wer am besten für ein artgerechtes Umfeld sorgen kann. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Ehemann diese Kriterien am besten erfüllt. Er konnte gewährleisten, dass der Hund in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann. Besonders wichtig war dabei die Möglichkeit für den Hund, sich frei im Garten zu bewegen. Dies wurde als erheblicher Zugewinn an Lebensqualität für das Tier gewertet.