Ein Urteil des Landgerichts Ellwangen vom März 2024 zeigt die Risiken des sogenannten Kolonnenspringen, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten und auf engen Straßen. Das Urteil stellt klar, dass beim Überholen in einer solchen Situation besondere Vorsicht geboten ist und Überholmanöver unter diesen Bedingungen als riskant einzustufen sind.
Im konkreten Fall ereignete sich ein Unfall auf einer engen Kreisstraße ohne Mittellinie, bei dem ein Teslafahrer eine Fahrzeugkolonne überholen wollte. Beim Versuch, mehrere Fahrzeuge gleichzeitig zu überholen, beschleunigte der Tesla auf 95 km/h und kollidierte mit einem in der Kolonne fahrenden Opel Astra. Das Gericht entschied, dass der Fahrer des Teslas allein für den Unfall verantwortlich sei, da er grob fahrlässig gehandelt habe.
Zwar darf eine Kolonne grundsätzlich überholt werden, jedoch müsse der Überholende die Verkehrsverhältnisse genau beachten. Im vorliegenden Fall war die Straße kurvig, ohne Bankett und nicht breit genug, um ein gefahrloses Überholen zu gewährleisten. Der Fahrer des Tesla hätte nicht darauf vertrauen dürfen, dass die anderen Fahrzeuge am äußersten rechten Rand der Fahrbahn fahren würden, um das Manöver („Kolonnenspringen“) zu erleichtern.
 Die Ellwanger Richter stellten zudem klar, dass der Fahrer des Opels keinen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot begangen habe. Aufgrund der Straßenverhältnisse sei es legitim, nicht direkt am äußersten rechten Fahrbahnrand zu fahren, um einen sicheren Abstand zur Straße und möglichen Hindernissen zu halten. Die Fahrbahn selbst war an der Unfallstelle nur fünf Meter breit, und es war keine Verpflichtung gegeben, dem Teslafahrer ein riskantes Überholmanöver zu ermöglichen.
Die Ellwanger Richter stellten zudem klar, dass der Fahrer des Opels keinen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot begangen habe. Aufgrund der Straßenverhältnisse sei es legitim, nicht direkt am äußersten rechten Fahrbahnrand zu fahren, um einen sicheren Abstand zur Straße und möglichen Hindernissen zu halten. Die Fahrbahn selbst war an der Unfallstelle nur fünf Meter breit, und es war keine Verpflichtung gegeben, dem Teslafahrer ein riskantes Überholmanöver zu ermöglichen.
Das Urteil verdeutlicht die Notwendigkeit, die Verkehrslage sorgfältig zu beurteilen, bevor ein Überholvorgang eingeleitet wird. Eine langsame Fahrt der vorausfahrenden Fahrzeuge allein reicht nicht aus, um eine klare Überholsituation zu begründen. Weitere Faktoren wie die Breite der Straße, Kurvenverläufe und fehlende Markierungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Einschätzung der Verkehrssituation.
Die Entscheidung des Landgerichts Ellwangen betont die Gefahren des Kolonnenspringen und die Verantwortung des Überholenden, die Verkehrslage richtig einzuschätzen. Es besteht keine Verpflichtung anderer Verkehrsteilnehmer, riskante Überholmanöver zu erleichtern, indem sie am äußersten Fahrbahnrand fahren.
Landgericht Ellwangen, Urteil vom 20.3.2024; AZ – 1 S 70/23 –
Foto: hykoe

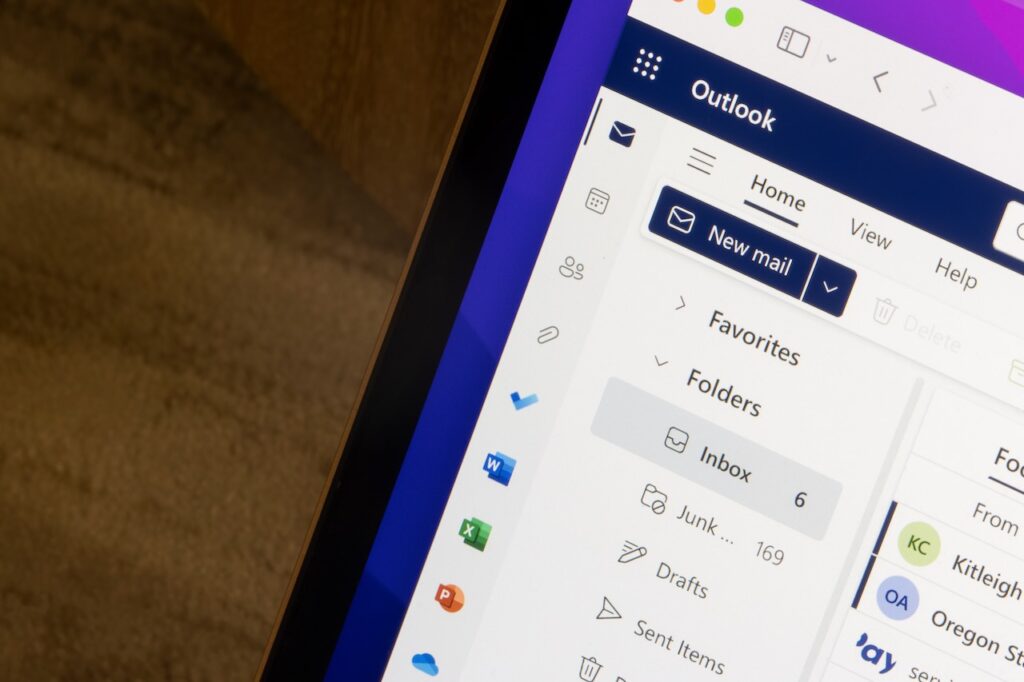 Im Fall von E-Mails wird jedoch festgehalten, dass der Empfang nicht so typisch ist, dass allein durch das Versenden auf den Zugang geschlossen werden kann. Es gibt immer wieder technische Gründe oder Filterungen, die den Empfang verhindern, was einen Anscheinsbeweis in solchen Fällen ausschließt.
Im Fall von E-Mails wird jedoch festgehalten, dass der Empfang nicht so typisch ist, dass allein durch das Versenden auf den Zugang geschlossen werden kann. Es gibt immer wieder technische Gründe oder Filterungen, die den Empfang verhindern, was einen Anscheinsbeweis in solchen Fällen ausschließt.

 Das Hessische Landessozialgericht stellte jedoch klar, dass die Regelungen des Gesetzgebers verfassungsgemäß seien. Rentner, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterhin eine Vollrente beziehen, sind versicherungsfrei, es sei denn, sie verzichten aktiv auf diese Versicherungsfreiheit. Nur in diesem Fall werden die Beiträge zur Rentenversicherung sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Rentner selbst geleistet und bei der Berechnung der Rentenhöhe berücksichtigt.
Das Hessische Landessozialgericht stellte jedoch klar, dass die Regelungen des Gesetzgebers verfassungsgemäß seien. Rentner, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterhin eine Vollrente beziehen, sind versicherungsfrei, es sei denn, sie verzichten aktiv auf diese Versicherungsfreiheit. Nur in diesem Fall werden die Beiträge zur Rentenversicherung sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Rentner selbst geleistet und bei der Berechnung der Rentenhöhe berücksichtigt. Für Beschuldigte ist es ratsam, von ihrem Schweigerecht Gebrauch zu machen und keine Aussagen ohne rechtlichen Beistand zu tätigen. Unüberlegte Äußerungen können später nur schwer korrigiert werden und die Verteidigung vor Gericht erschweren. Daher ist es vorteilhaft, einen Anwalt hinzuzuziehen, der die Kommunikation mit den Behörden übernimmt und die notwendigen Schritte einleitet. Zeugen hingegen haben in der Regel keinen Grund, einer polizeilichen Vorladung nicht nachzukommen. Allerdings kann es Situationen geben, in denen Zeugen durch ihre Aussage selbst in den Fokus der Ermittlungen geraten könnten.
Für Beschuldigte ist es ratsam, von ihrem Schweigerecht Gebrauch zu machen und keine Aussagen ohne rechtlichen Beistand zu tätigen. Unüberlegte Äußerungen können später nur schwer korrigiert werden und die Verteidigung vor Gericht erschweren. Daher ist es vorteilhaft, einen Anwalt hinzuzuziehen, der die Kommunikation mit den Behörden übernimmt und die notwendigen Schritte einleitet. Zeugen hingegen haben in der Regel keinen Grund, einer polizeilichen Vorladung nicht nachzukommen. Allerdings kann es Situationen geben, in denen Zeugen durch ihre Aussage selbst in den Fokus der Ermittlungen geraten könnten. Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro.
Das Reiseunternehmen sei berechtigt, so die Richter, aufgrund des Rücktritts vom Vertrag vor Reisebeginn eine angemessene Entschädigung in Höhe von 3.859 Euro zu verlangen. Es hatte schlüssig dargelegt, dass es für die Buchung der einzelnen Reiseleistungen wie Flüge und Hotel in Vorleistung gehen musste. Die Gesamtaufwendungen beliefen sich auf 4.036 Euro.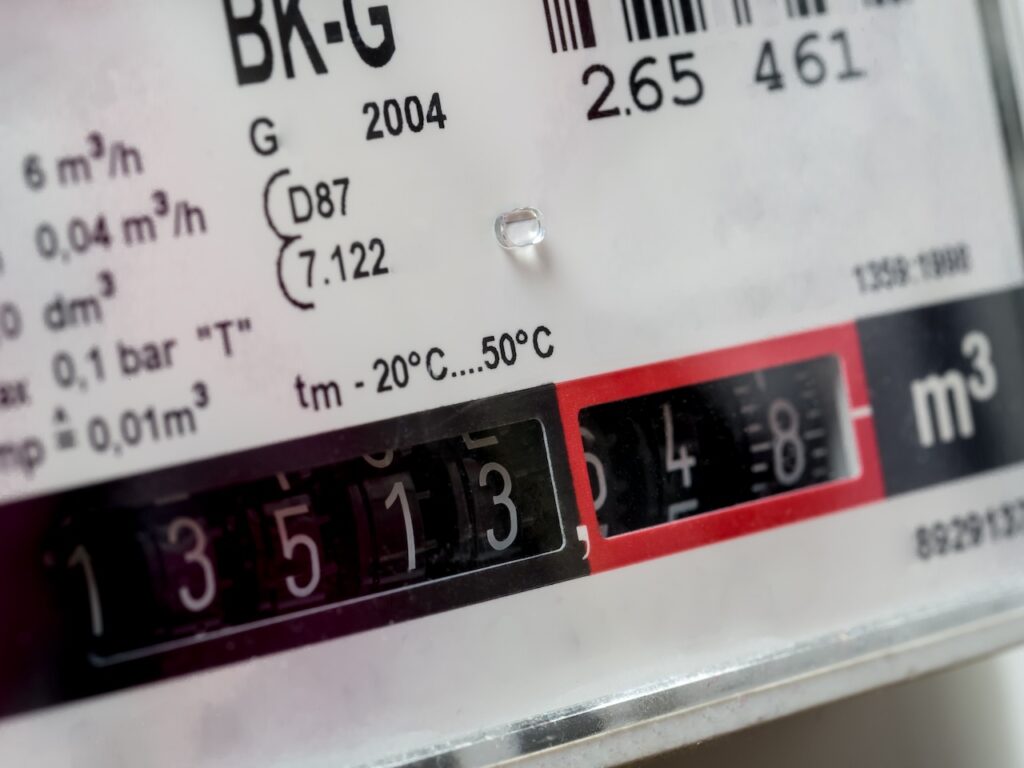 Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung.
Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils war die Verpflichtung der Klägerin, das tatsächlich verbrauchte Gas auch zu bezahlen. Das Gericht betonte, dass die Klägerin die Möglichkeit gehabt hätte, den Verbrauch am Ende des ersten Jahres selbst abzulesen, um eine genauere Verteilung der Kosten zu gewährleisten. Da diese Möglichkeit von der Klägerin nicht genutzt wurde, sei die Beklagte berechtigt gewesen, die Schätzwerte anzusetzen. Die Schätzung des ersten Jahres und die Korrektur im zweiten Jahr entsprachen den gesetzlichen Abrechnungsmechanismen und führten insgesamt nicht zu einer fehlerhaften Gesamtabrechnung. Das Oberverwaltungsgericht stellte klar, dass die Errichtung und der Betrieb der Kleinwind-Energieanlagen ein privilegiertes Vorhaben im Sinne des Baugesetzbuchs darstellt. Die Privilegierung beziehe sich auf die Nutzung der Windenergie, unabhängig davon, ob der erzeugte Strom ins öffentliche Netz eingespeist oder für den privaten Verbrauch genutzt wird. Diese Auslegung unterstützt den umwelt- und ressourcenschonenden Ansatz der gesetzlichen Regelung und trägt zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei.
Das Oberverwaltungsgericht stellte klar, dass die Errichtung und der Betrieb der Kleinwind-Energieanlagen ein privilegiertes Vorhaben im Sinne des Baugesetzbuchs darstellt. Die Privilegierung beziehe sich auf die Nutzung der Windenergie, unabhängig davon, ob der erzeugte Strom ins öffentliche Netz eingespeist oder für den privaten Verbrauch genutzt wird. Diese Auslegung unterstützt den umwelt- und ressourcenschonenden Ansatz der gesetzlichen Regelung und trägt zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei. Die KfW verweigerte jedoch die Auszahlung der Fördermittel mit der Begründung, dass die Umwandlung in Wohnungseigentum bereits deutlich vor der Antragstellung hätte erfolgen müssen. Dies führte in der Konsequenz zu einer erheblichen finanziellen Belastung für die Eigentümerin, die daraufhin den Architekten auf Schadensersatz verklagte.
Die KfW verweigerte jedoch die Auszahlung der Fördermittel mit der Begründung, dass die Umwandlung in Wohnungseigentum bereits deutlich vor der Antragstellung hätte erfolgen müssen. Dies führte in der Konsequenz zu einer erheblichen finanziellen Belastung für die Eigentümerin, die daraufhin den Architekten auf Schadensersatz verklagte.