Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat im Juni 2025 eine bedeutsame Entscheidung zu Hass-Accounts auf Facebook getroffen. Der für Presserecht zuständige 16. Zivilsenat gab einer Klägerin Recht, die von der Plattformbetreiberin nicht nur die Löschung beleidigender Beiträge, sondern die Entfernung ganzer Nutzerkonten verlangt hatte. Das Gericht bejahte einen solchen Löschungsanspruch unter bestimmten Voraussetzungen.
Im zugrundeliegenden Fall hatte eine Frau gegen die Betreiberin von Facebook geklagt. Unbekannte Personen hatten zwei Nutzerkonten angelegt, über die sie ausschließlich beleidigende und herabsetzende Inhalte über die Klägerin verbreiteten. Die Äußerungen umfassten unter anderem Beschimpfungen wie „Du dumme Sau“ und „frigide menopausierende Schnepfe“. Das Landgericht hatte die Klage zunächst abgewiesen, doch das Oberlandesgericht hob diese Entscheidung auf und gab der Klägerin in der Berufung Recht.
Der Senat stellte fest, dass sämtliche auf einem der Profile geposteten Äußerungen herabsetzende Werturteile darstellten. Sachliche Anknüpfungspunkte für diese Äußerungen erkannte das Gericht nicht. Die Klägerin war in ihrem Bekanntenkreis als betroffene Person identifizierbar, da auf dem Profil Bilder von ihr veröffentlicht worden waren. Bei dem zweiten Nutzerkonto lag die Persönlichkeitsverletzung nach Auffassung des Senats bereits in der Verfremdung des Namens der Klägerin, die als Beleidigung zu werten sei. Der gewählte Profilname bilde den Namen der Klägerin in verfremdender Weise nach, sei aber bildlich und klanglich erkennbar. 
Das Oberlandesgericht begründete die Pflicht zur Kontolöschung mit einer Interessenabwägung. Wenn ein Nutzerkonto nach den Gesamtumständen ausschließlich dazu dient, rechtsverletzende Äußerungen über eine Person zu veröffentlichen, überwiegt das Interesse des Betroffenen. Die Löschung des gesamten Kontos stelle dann das effektivere Mittel dar, um vergleichbaren Rechtsverletzungen vorzubeugen. Das Gericht räumte ein, dass eine Kontolöschung zwar erheblich in die unternehmerische Freiheit eingreife. Angesichts der Tatsache, dass auf den Konten ausschließlich persönlichkeitsverletzende Inhalte gepostet worden waren, und angesichts der Vielzahl der Äußerungen sei die Maßnahme jedoch verhältnismäßig.
Facebook haftet in diesem Fall als mittelbare Störerin. Die Klägerin hatte die Plattform vor dem Prozess hinreichend konkret auf die Persönlichkeitsverletzungen hingewiesen. Eine solche vorherige Inkenntnissetzung bildet die Voraussetzung für die Haftung des Plattformbetreibers.
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die unterlegene Partei kann mit der Nichtzulassungsbeschwerde die Zulassung der Revision beim Bundesgerichtshof begehren.
Urteil des Oberlandesgericht Frankfurt am Main vom 26.6. 2025; AZ – 16 U 58/24 –
Foto: Rokas

 Das Gericht stellte jedoch fest, dass die Beschriftung „Senden“ den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt. Der Gesetzgeber verlangt eine unmissverständliche Kennzeichnung, die dem Verbraucher vor Augen führt, dass mit dem Klick finanzielle Verpflichtungen entstehen können. Dabei spielt es keine Rolle, dass bei Maklerverträgen die Zahlungspflicht erst eintritt, wenn tatsächlich ein Kaufvertrag zustande kommt. Der Europäische Gerichtshof hatte bereits entschieden, dass der Verbraucherschutz auch bei bedingten Zahlungspflichten greift.
Das Gericht stellte jedoch fest, dass die Beschriftung „Senden“ den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt. Der Gesetzgeber verlangt eine unmissverständliche Kennzeichnung, die dem Verbraucher vor Augen führt, dass mit dem Klick finanzielle Verpflichtungen entstehen können. Dabei spielt es keine Rolle, dass bei Maklerverträgen die Zahlungspflicht erst eintritt, wenn tatsächlich ein Kaufvertrag zustande kommt. Der Europäische Gerichtshof hatte bereits entschieden, dass der Verbraucherschutz auch bei bedingten Zahlungspflichten greift. Die Entscheidung hatte konkrete Folgen für den vorliegenden Fall. Das Gericht hob eine zuvor erlassene einstweilige Verfügung auf, da das Abmahnschreiben dem Empfänger nie rechtswirksam zugegangen war. Der Versandhändler konnte sich erfolgreich darauf berufen, dass er den verdächtig benannten Dateianhang aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet hatte.
Die Entscheidung hatte konkrete Folgen für den vorliegenden Fall. Das Gericht hob eine zuvor erlassene einstweilige Verfügung auf, da das Abmahnschreiben dem Empfänger nie rechtswirksam zugegangen war. Der Versandhändler konnte sich erfolgreich darauf berufen, dass er den verdächtig benannten Dateianhang aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet hatte. Das Gericht betonte in seiner Urteilsbegründung, dass Durchschnittsreisende bei Flugbuchungen zwar an Visumserfordernisse für das Zielland denken, jedoch nicht automatisch an Transitgenehmigungen für reine Zwischenstopps. Diese Wissenslücke führt zu einem erheblichen Informationsgefälle zwischen Verbrauchern und professionellen Reisevermittlern.
Das Gericht betonte in seiner Urteilsbegründung, dass Durchschnittsreisende bei Flugbuchungen zwar an Visumserfordernisse für das Zielland denken, jedoch nicht automatisch an Transitgenehmigungen für reine Zwischenstopps. Diese Wissenslücke führt zu einem erheblichen Informationsgefälle zwischen Verbrauchern und professionellen Reisevermittlern. Im konkreten Fall hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) eine Klage gegen Apple Distribution International Ltd. eingereicht. Im „App Store“ werden bei der Beschreibung von Anwendungen die üblichen Sternebewertungen sowie Rezensionen von Nutzern angezeigt, einschließlich des Durchschnittswerts und der Verteilung der Bewertungen. Allerdings prüft Apple nicht, ob die Bewertungen von Personen stammen, die die jeweilige App tatsächlich auch genutzt haben. Dieser wichtige Umstand wurde nur in den Nutzungsbedingungen unter der Überschrift „Deine Beiträge zu unseren Diensten“ erwähnt.
Im konkreten Fall hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) eine Klage gegen Apple Distribution International Ltd. eingereicht. Im „App Store“ werden bei der Beschreibung von Anwendungen die üblichen Sternebewertungen sowie Rezensionen von Nutzern angezeigt, einschließlich des Durchschnittswerts und der Verteilung der Bewertungen. Allerdings prüft Apple nicht, ob die Bewertungen von Personen stammen, die die jeweilige App tatsächlich auch genutzt haben. Dieser wichtige Umstand wurde nur in den Nutzungsbedingungen unter der Überschrift „Deine Beiträge zu unseren Diensten“ erwähnt.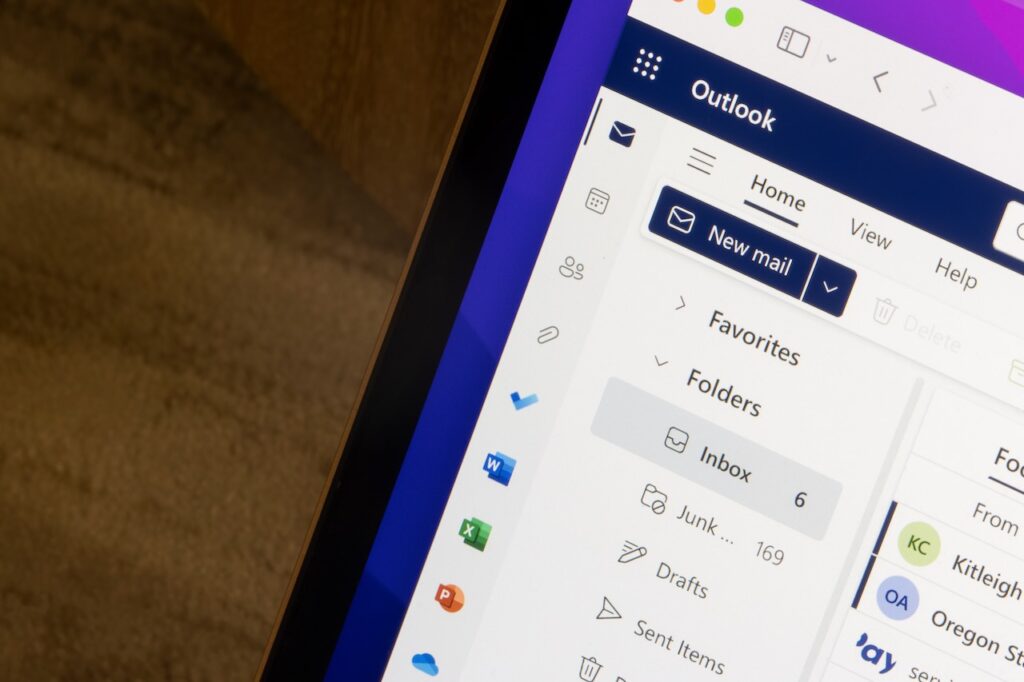 Im Fall von E-Mails wird jedoch festgehalten, dass der Empfang nicht so typisch ist, dass allein durch das Versenden auf den Zugang geschlossen werden kann. Es gibt immer wieder technische Gründe oder Filterungen, die den Empfang verhindern, was einen Anscheinsbeweis in solchen Fällen ausschließt.
Im Fall von E-Mails wird jedoch festgehalten, dass der Empfang nicht so typisch ist, dass allein durch das Versenden auf den Zugang geschlossen werden kann. Es gibt immer wieder technische Gründe oder Filterungen, die den Empfang verhindern, was einen Anscheinsbeweis in solchen Fällen ausschließt.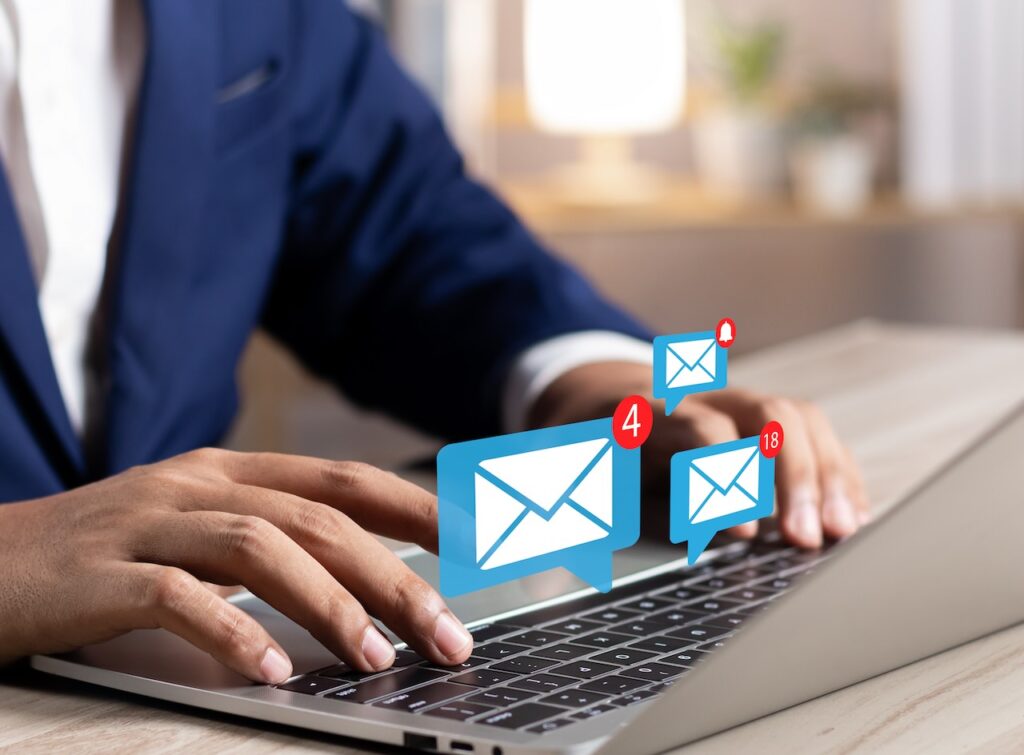
 Der Fall zeigt deutlich, dass die Sicherheit im Online-Banking nicht allein durch technische Maßnahmen gewährleistet werden kann. Nutzer müssen aktiv an der Sicherung ihrer finanziellen Transaktionen mitwirken. Es ist entscheidend, dass Benachrichtigungen auf ihre Authentizität hin überprüft werden, insbesondere wenn sie zur Freigabe von Transaktionen auffordern. In diesem Fall wurde der Kläger aufgrund seiner beruflichen Erfahrung und seiner Kenntnisse im Umgang mit Online-Banking als grob fahrlässig eingestuft.
Der Fall zeigt deutlich, dass die Sicherheit im Online-Banking nicht allein durch technische Maßnahmen gewährleistet werden kann. Nutzer müssen aktiv an der Sicherung ihrer finanziellen Transaktionen mitwirken. Es ist entscheidend, dass Benachrichtigungen auf ihre Authentizität hin überprüft werden, insbesondere wenn sie zur Freigabe von Transaktionen auffordern. In diesem Fall wurde der Kläger aufgrund seiner beruflichen Erfahrung und seiner Kenntnisse im Umgang mit Online-Banking als grob fahrlässig eingestuft. Die Angreifer bedienen sich oft namhaft klingender Unternehmen oder Institutionen, die beispielsweise im Finanz- oder Handelsbereich ansässig sind. Der Begriff Phishing stammt aus dem englischsprachigen Raum und bezeichnet im Prinzip einen Angelausflug. Hierbei dient eine eigens für den Angriff konzipierte E-Mail dem Cyberkriminellen als Köder, wobei er diesen gleich mehrfach an seine möglichen Opfer, wie z.B. an Mitarbeiter eines Unternehmens, weiterleitet.
Die Angreifer bedienen sich oft namhaft klingender Unternehmen oder Institutionen, die beispielsweise im Finanz- oder Handelsbereich ansässig sind. Der Begriff Phishing stammt aus dem englischsprachigen Raum und bezeichnet im Prinzip einen Angelausflug. Hierbei dient eine eigens für den Angriff konzipierte E-Mail dem Cyberkriminellen als Köder, wobei er diesen gleich mehrfach an seine möglichen Opfer, wie z.B. an Mitarbeiter eines Unternehmens, weiterleitet. Das Landgericht Frankenthal bestätigte diese Kündigung und unterstrich damit die Bedeutung eines respektvollen Umgangs in Social-Media, insbesondere in Bezug auf geschäftliche Beziehungen. Das Gericht erachtete die beleidigenden Posts als ausreichenden Grund für eine außerordentliche Kündigung. Hierbei spielte es keine Rolle, dass zwischen den Parteien bereits vorher Konflikte bestanden hatten. Entscheidend war die Art und Weise der Äußerungen des Gastwirts, die als persönliche Herabsetzung und Beleidigung eines Vorstandsmitglieds gewertet wurden.
Das Landgericht Frankenthal bestätigte diese Kündigung und unterstrich damit die Bedeutung eines respektvollen Umgangs in Social-Media, insbesondere in Bezug auf geschäftliche Beziehungen. Das Gericht erachtete die beleidigenden Posts als ausreichenden Grund für eine außerordentliche Kündigung. Hierbei spielte es keine Rolle, dass zwischen den Parteien bereits vorher Konflikte bestanden hatten. Entscheidend war die Art und Weise der Äußerungen des Gastwirts, die als persönliche Herabsetzung und Beleidigung eines Vorstandsmitglieds gewertet wurden.