Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat sich im Mai 2025 ausführlich mit der Frage beschäftigt, welche Anforderungen an ein Messprotokoll bei Geschwindigkeitsverstößen zu stellen sind. Im Kern ging es darum: Muss ein Messprotokoll formal perfekt ausgefüllt sein, oder kommt es darauf an, ob die Messung selbst korrekt ablief? Die Frankfurter Richter entschieden klar zugunsten der zweiten Variante. Diese Unterscheidung hat erhebliche praktische Auswirkungen für alle, die einen Bußgeldbescheid wegen zu schnellem Fahren erhalten haben.
Der zugrundeliegende Fall betraf einen Autofahrer, den ein Blitzer innerhalb einer geschlossenen Ortschaft mit 90 km/h erfasste, obwohl dort nur 50 km/h galten. Nach Abzug der üblichen Toleranz ergab sich eine Überschreitung von 40 km/h. Das Amtsgericht Kassel verurteilte den bereits mehrfach auffällig gewordenen Fahrer zu einer Geldbuße von 1.000 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot. Der ursprüngliche Bußgeldbescheid sah lediglich 520 Euro und einen Monat Fahrverbot vor. Das Gericht ging jedoch davon aus, dass der Fahrer absichtlich so schnell unterwegs war – und verhängte deshalb eine deutlich höhere Strafe.
Der Fahrer legte gegen diese Entscheidung Rechtsmittel ein und beanstandete unter anderem ein angeblich lückenhaftes Messprotokoll. Das Oberlandesgericht wies diesen Einwand jedoch zurück. Die Begründung: Der Einwand sei viel zu ungenau geblieben. Es reiche nicht aus, einfach zu behaupten, das Messprotokoll habe Lücken. Vielmehr müsse ein Anwalt konkrete Fehler oder Unstimmigkeiten benennen – und zwar anhand der sogenannten Falldatei. Diese Datei speichert das Messgerät bei jedem Blitzervorgang automatisch ab. Sie enthält neben dem Foto auch technische Daten zur Messung selbst. Im vorliegenden Fall zeigte das Blitzerfoto nach Ansicht des Gerichts keinerlei Auffälligkeiten: Es war lediglich ein einzelner Fahrer zu sehen, der kurz nach Mitternacht durch die Kasseler Innenstadt fuhr.

Das Gericht nutzte die Gelegenheit, um einige grundsätzliche Dinge zum Umgang mit Messprotokollen klarzustellen. Ein Messprotokoll bei Geschwindigkeitsverstößen ist ein offizielles Dokument, das festhält, wie eine Geschwindigkeitsmessung abgelaufen ist. Gerichte dürfen dieses Protokoll in Bußgeldverfahren einfach vorlesen, ohne den Messbeamten extra als Zeugen laden zu müssen. Das spart Zeit und Aufwand. Ist das Protokoll allerdings unvollständig oder fehlerhaft, muss der Messbeamte doch persönlich erscheinen und aussagen.
Der springende Punkt ist nach Ansicht des Gerichts folgender: Es kommt nicht darauf an, ob jedes Kreuzchen im Protokoll sitzt. Entscheidend ist, ob die Messung selbst ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Problematisch wird es, wenn der Messbeamte bei einer Befragung vor Gericht keine Erinnerung mehr an den konkreten Vorgang hat – was bei Messungen, die oft viele Monate zurückliegen, durchaus vorkommt. In solchen Fällen kann das Gericht nicht mehr einfach davon ausgehen, dass alles korrekt ablief. Es muss dann alle vorhandenen Beweise selbst prüfen, also auch die technischen Daten aus der Falldatei genau unter die Lupe nehmen.
Für alle, die einen Bußgeldbescheid anfechten möchten, ergibt sich daraus eine wichtige Erkenntnis: Wer ein Messprotokoll angreifen will, muss konkret werden. Vor dem Gerichtstermin sollte ein Anwalt die Falldatei genau analysieren und dem Gericht aufzeigen, an welchen Stellen es Ungereimtheiten gibt. Nur dann ist das Gericht verpflichtet, diesen Punkten nachzugehen. Allgemeine Einwände nach dem Motto „Das Protokoll ist lückenhaft“ führen dagegen nicht zum Erfolg. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt ist rechtskräftig und kann nicht mehr angefochten werden.
Beschluss des Oberlandesgericht Frankfurt am Main vom 5.5.2025; AZ – 2 Orbs 69/25 –
Foto: U. J. Alexander


 Bemerkenswert ist die deutliche Formulierung des Gerichts zur behaupteten Verwirrung: Wenn ein Verkehrsteilnehmer eine einfache und klar verständliche Verkehrsanordnung nicht versteht, begründet dies keinen Verbotsirrtum, der entlasten könnte. Vielmehr stelle sich dann die Frage, ob die betreffende Person kognitiv überhaupt in der Lage sei, am Straßenverkehr teilzunehmen.
Bemerkenswert ist die deutliche Formulierung des Gerichts zur behaupteten Verwirrung: Wenn ein Verkehrsteilnehmer eine einfache und klar verständliche Verkehrsanordnung nicht versteht, begründet dies keinen Verbotsirrtum, der entlasten könnte. Vielmehr stelle sich dann die Frage, ob die betreffende Person kognitiv überhaupt in der Lage sei, am Straßenverkehr teilzunehmen.
 Besonders schwerwiegend wertete das Gericht die Tatsache, dass zum Unfallzeitpunkt freie Sitzplätze verfügbar waren – der Kläger also die (Eigen-) Sicherung im Linienbus nicht ernst nahm. Ein Sitzplatz direkt hinter der Position des Fahrgasts hätte nicht nur eine sichere Sitzgelegenheit, sondern auch eine zusätzliche Haltestange geboten. Im Stadtverkehr muss grundsätzlich mit plötzlichen Bremsmanövern gerechnet werden. Eine vorausgehende leichte Bremsung des Busses etwa 50 Meter vor dem eigentlichen Vorfall hätte dem Fahrgast bereits signalisieren können, dass seine Position keinen ausreichenden Halt bot.
Besonders schwerwiegend wertete das Gericht die Tatsache, dass zum Unfallzeitpunkt freie Sitzplätze verfügbar waren – der Kläger also die (Eigen-) Sicherung im Linienbus nicht ernst nahm. Ein Sitzplatz direkt hinter der Position des Fahrgasts hätte nicht nur eine sichere Sitzgelegenheit, sondern auch eine zusätzliche Haltestange geboten. Im Stadtverkehr muss grundsätzlich mit plötzlichen Bremsmanövern gerechnet werden. Eine vorausgehende leichte Bremsung des Busses etwa 50 Meter vor dem eigentlichen Vorfall hätte dem Fahrgast bereits signalisieren können, dass seine Position keinen ausreichenden Halt bot. Die Ellwanger Richter stellten zudem klar, dass der Fahrer des Opels keinen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot begangen habe. Aufgrund der Straßenverhältnisse sei es legitim, nicht direkt am äußersten rechten Fahrbahnrand zu fahren, um einen sicheren Abstand zur Straße und möglichen Hindernissen zu halten. Die Fahrbahn selbst war an der Unfallstelle nur fünf Meter breit, und es war keine Verpflichtung gegeben, dem Teslafahrer ein riskantes Überholmanöver zu ermöglichen.
Die Ellwanger Richter stellten zudem klar, dass der Fahrer des Opels keinen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot begangen habe. Aufgrund der Straßenverhältnisse sei es legitim, nicht direkt am äußersten rechten Fahrbahnrand zu fahren, um einen sicheren Abstand zur Straße und möglichen Hindernissen zu halten. Die Fahrbahn selbst war an der Unfallstelle nur fünf Meter breit, und es war keine Verpflichtung gegeben, dem Teslafahrer ein riskantes Überholmanöver zu ermöglichen.
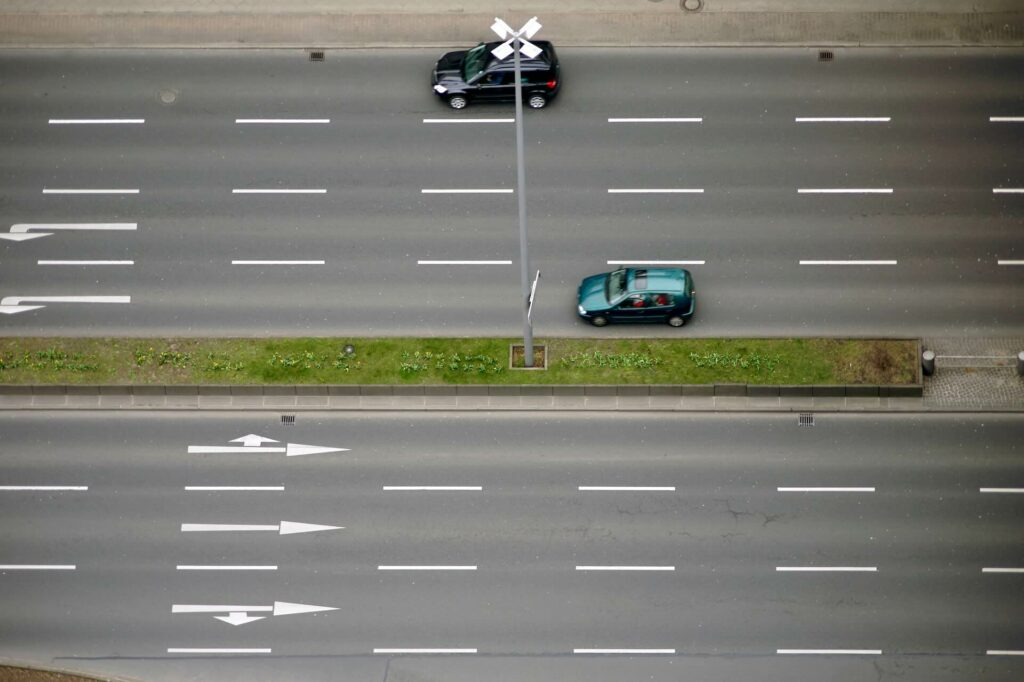 Das Landgericht Saarbrücken wies die Schadensersatzforderung des Linksabbiegers ab, eine Entscheidung, die durch die Berufung beim Oberlandesgericht Saarbrücken bestätigt wurde. Die Richter stellten klar, dass der Linksabbieger eine bestehende Wartepflicht verletzt hatte. Die entscheidende Erkenntnis aus dem Urteil ist, dass beim Abbiegen in Straßen mit mehreren Fahrspuren kein Verlass darauf besteht, dass ein entgegenkommender Abbieger die für ihn vermeintlich „richtige“ Spur wählt. Tatsächlich umfasse der Vorrang des Rechtsabbiegers auch die Freiheit, zwischen mehreren Fahrspuren zu wählen, ohne dass dies als Fahrstreifenwechsel im Sinne eines Verstoßes gegen die StVO angesehen wird, so das Saarbrücker Gericht.
Das Landgericht Saarbrücken wies die Schadensersatzforderung des Linksabbiegers ab, eine Entscheidung, die durch die Berufung beim Oberlandesgericht Saarbrücken bestätigt wurde. Die Richter stellten klar, dass der Linksabbieger eine bestehende Wartepflicht verletzt hatte. Die entscheidende Erkenntnis aus dem Urteil ist, dass beim Abbiegen in Straßen mit mehreren Fahrspuren kein Verlass darauf besteht, dass ein entgegenkommender Abbieger die für ihn vermeintlich „richtige“ Spur wählt. Tatsächlich umfasse der Vorrang des Rechtsabbiegers auch die Freiheit, zwischen mehreren Fahrspuren zu wählen, ohne dass dies als Fahrstreifenwechsel im Sinne eines Verstoßes gegen die StVO angesehen wird, so das Saarbrücker Gericht. Die Entscheidung des Amtsgerichts, von einer Entziehung der Fahrerlaubnis abzusehen, wurde vom Oberlandesgericht nicht geteilt. Vielmehr betonte das Gericht, dass die Fahrt mit einem E-Scooter im betrunkenen Zustand grundsätzlich als Indiz für die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen angesehen wird. Diese Sichtweise berücksichtigt das Gefährdungspotential, das von E-Scootern ausgeht, und stellt sie Fahrrädern gleich. Dabei wurde auch auf die bestehende Rechtsprechung verwiesen, die für Fahrradfahrer einen Grenzwert von 1,6 Promille ansetzt, während die Frage, ob der Grenzwert für Kraftfahrzeugführer von 1,1 Promille auch für E-Scooter gilt, offenblieb. Ein Fahrerlaubnisentzug wegen Trunkenheit ist daher nicht ungewöhnlich.
Die Entscheidung des Amtsgerichts, von einer Entziehung der Fahrerlaubnis abzusehen, wurde vom Oberlandesgericht nicht geteilt. Vielmehr betonte das Gericht, dass die Fahrt mit einem E-Scooter im betrunkenen Zustand grundsätzlich als Indiz für die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen angesehen wird. Diese Sichtweise berücksichtigt das Gefährdungspotential, das von E-Scootern ausgeht, und stellt sie Fahrrädern gleich. Dabei wurde auch auf die bestehende Rechtsprechung verwiesen, die für Fahrradfahrer einen Grenzwert von 1,6 Promille ansetzt, während die Frage, ob der Grenzwert für Kraftfahrzeugführer von 1,1 Promille auch für E-Scooter gilt, offenblieb. Ein Fahrerlaubnisentzug wegen Trunkenheit ist daher nicht ungewöhnlich. Ein Urteil aus Niedersachsen vom August 2023 illustriert die Ernsthaftigkeit solcher Bestimmungen. Ein Radfahrer wurde mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,95 Promille aufgegriffen. Ein daraufhin erstelltes medizinisch-psychologisches Gutachten bestätigte eine hohe Wahrscheinlichkeit der Wiederholung ähnlicher Vorfälle. Daraufhin verhängten die Behörden ein sofortiges Fahrverbot. Die rechtliche Grundlage für dieses Verbot findet sich in § 3 FeV (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr).
Ein Urteil aus Niedersachsen vom August 2023 illustriert die Ernsthaftigkeit solcher Bestimmungen. Ein Radfahrer wurde mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,95 Promille aufgegriffen. Ein daraufhin erstelltes medizinisch-psychologisches Gutachten bestätigte eine hohe Wahrscheinlichkeit der Wiederholung ähnlicher Vorfälle. Daraufhin verhängten die Behörden ein sofortiges Fahrverbot. Die rechtliche Grundlage für dieses Verbot findet sich in § 3 FeV (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr).