Ein Restaurant in Osnabrück erlitt im Januar 2018 erhebliche Schäden durch ein Feuer, wodurch die Inneneinrichtung beschädigt wurde. Ein beauftragter Sachverständiger schätzte den Schaden auf rund 640.000 Euro. Es kam der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung auf, doch eine Person, die wegen dieses Verdachts vor Gericht stand, wurde freigesprochen.
Letztlich musste aber über die Mitwirkungspflichten von Versicherungsnehmern entscheiden werden.
Das Restaurant, das sich der Schwere des Vorfalls bewusst war, meldete den Schaden unverzüglich seinem Versicherer. Als Reaktion darauf erhielt die Besitzerin einen Fragekatalog mit 20 Fragen vom Versicherer, der zur weiteren Abwicklung des Falls dienen sollte. Trotz der Unterstützung durch ein spezialisiertes Unternehmen zur Schadensregulierung und späterer Vertretung durch mehrere Rechtsanwälte, dauerte es Monate, bis auf die Fragen reagiert wurde. Und selbst dann wurden sie nicht in Gänze beantwortet. 
Der Versicherer interpretierte dieses Verhalten als Verstoß gegen die Mitwirkungspflicht. Er wies darauf hin, dass eine solche Verletzung der Pflicht eine Ablehnung der Deckung des Schadens oder eine Leistungskürzung zur Folge haben könnte – eine Regelung, die dem Restaurantbesitzer auch zuvor ganz klar mitgeteilt worden war.
Das Landgericht Osnabrück hatte sich schließlich mit diesem Fall zu beschäftigen und entschied zugunsten des Versicherers. Es wies die Klage des Restaurants ab, wobei die Hauptbegründung darin bestand, dass die Fragen des Versicherers nicht rechtzeitig und in der erwarteten Art und Weise beantwortet wurden. Diese Fragen hätten für die Einschätzung der Einstandspflicht des Versicherers relevant sein können. Es wurde auch betont, dass im Versicherungsrecht der Grundsatz, dass niemand verpflichtet ist, sich selbst zu belasten, nicht gilt. Die Besitzerin hatte ausreichend Zeit, die Fragen zu beantworten, hat es jedoch versäumt.
Zusätzlich war es dem Restaurant klar, dass die unzureichende Beantwortung der Fragen den Versicherungsfall beeinflussen könnte, besonders unter dem Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung. Die verspätete und unvollständige Beantwortung galt als Versuch, den Verlust des Leistungsanspruchs zu minimieren. Der im Strafrecht geltende Grundsatz „Nemo tenetur se ipsum accusare“ (deutsch: Aussageverweigerungsrecht) wonach sich niemand selbst zu belasten brauche, gelte im Verhältnis zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer nicht, betonten die Richter in Osnabrück ganz nachrücklich.
Die Entscheidung ist nicht endgültig und kann beim Oberlandesgericht Oldenburg angefochten werden.
Landgericht Osnabrück, Urteil vom 24.5.2023; AZ – 9 O 3254/21 –
Foto: EdNurg

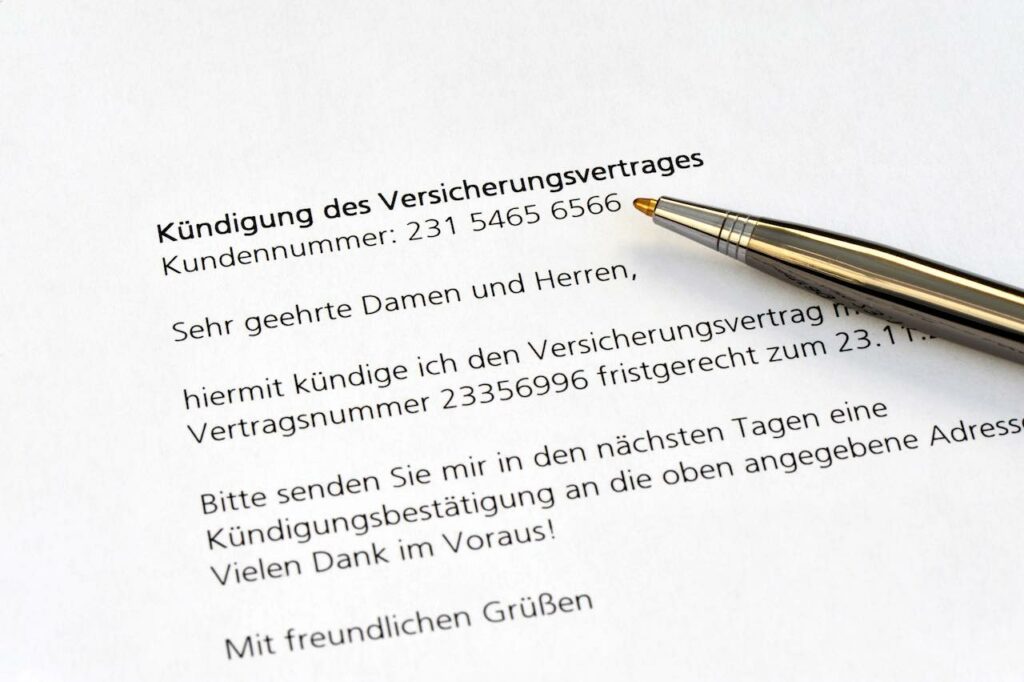


 Das Landgericht hat dazu ausgeführt, dass das Einwerfen eines Schlüssels in den Briefkasten eines Autohauses im Grunde zwar den Tatbestand der groben Fahrlässigkeit erfüllen kann. Dieser Grundsatz gelte aber nicht ohne Weiteres. Entscheidend seien vielmehr die Umstände des Einzelfalles.
Das Landgericht hat dazu ausgeführt, dass das Einwerfen eines Schlüssels in den Briefkasten eines Autohauses im Grunde zwar den Tatbestand der groben Fahrlässigkeit erfüllen kann. Dieser Grundsatz gelte aber nicht ohne Weiteres. Entscheidend seien vielmehr die Umstände des Einzelfalles. Die Gegenseite meinte aber, dass von dem Brutto-Wiederbeschaffungswert die Umsatzsteuer von 19 Prozent abzuziehen sei. Sowohl das zuvor angerufene Amtsgericht als auch das Landgericht Heidelberg gaben der Klage des Unfallgeschädigten statt. Und so musste der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden.
Die Gegenseite meinte aber, dass von dem Brutto-Wiederbeschaffungswert die Umsatzsteuer von 19 Prozent abzuziehen sei. Sowohl das zuvor angerufene Amtsgericht als auch das Landgericht Heidelberg gaben der Klage des Unfallgeschädigten statt. Und so musste der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden. Mit ihrem Urteil waren sich die Richter des Bundesgerichtshofes (BGH 22.02.2018, Az. VII ZR 46/17 ) im Werkvertragsrecht (hier Baurecht) durchaus im Klaren darüber, was sie mit ihrer Entscheidung ins Rollen bringen – sie räumten auch ein, dass das derzeitige System der Schadensabwicklung auf der Grundlage fiktiver Reparaturkosten wohlvertraut sei und – was seine technische Abwicklung betrifft – im Wesentlichen reibungslos funktioniere. Klar wurde aber auch, dass das langfristige Ziel bei diesem Urteil die generelle Unterbindung von unrechtmäßigen Bereicherungen und damit wichtiger als die Aufrechterhaltung des Status quo sei.
Mit ihrem Urteil waren sich die Richter des Bundesgerichtshofes (BGH 22.02.2018, Az. VII ZR 46/17 ) im Werkvertragsrecht (hier Baurecht) durchaus im Klaren darüber, was sie mit ihrer Entscheidung ins Rollen bringen – sie räumten auch ein, dass das derzeitige System der Schadensabwicklung auf der Grundlage fiktiver Reparaturkosten wohlvertraut sei und – was seine technische Abwicklung betrifft – im Wesentlichen reibungslos funktioniere. Klar wurde aber auch, dass das langfristige Ziel bei diesem Urteil die generelle Unterbindung von unrechtmäßigen Bereicherungen und damit wichtiger als die Aufrechterhaltung des Status quo sei.